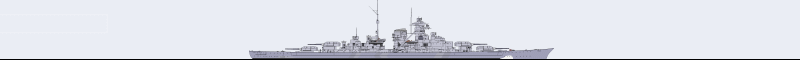Es ist 20 Uhr, die Backbordkriegswache hat abgelöst, und die Kampfgruppe steuert in Dwarslinie, die Zerstörer als Unterseeboots-Sicherung herausgesetzt, Zickzackkurse. Himmel, See und die nahen Felsberge Norwegens liegen wie in einen Farbenrausch von rosa, rot, violett, blau und grau getaucht. Nur auf See und in der Wüste sind solche Farben anzutreffen, solch tausendfache Schattierungen vom zartesten Rosa bis zum Tiefviolett. Es ist einfach unbeschreiblich schön, und man glaubt zu träumen, wenn man hinüberschaut zur Küste, zu den rot übergossenen Schären, die blankgewaschen von der Brandung glänzen, als seien sie eben mit breitem Pinsel und frischer Farbe neu gemalt worden. Selbst die Brandung, die in langen Zwischenräumen bei der heute verhältnismäßig ruhigen See an den Klippen und Riften hochschäumt, ist himbeer- und kirschfarben. Die Felsberge, kulissenartig hintereinander aufwuchtend, zeigen Farbtöne, die unwahrscheinlich zart wirken, die sich in den dahinter liegenden Felsen, in den tief eingeschnittenen Schluchten kleiner Fjords und Wasserläufe über ein sattes Blaurot zu dunkelstem Lila verdichten. Über allem spannt sich ein Himmel, wie ich ihn sonst nur noch in der Wüste, etwa beim Blick von der Cheopspyramide zum Mokattamgebirge bei untergehender Sonne erlebte: ein unwirklich feines, goldschimmernd
Gespinst von allerzartesten rötlichen Schattierungen, ein goldfarbener, mit Rosa überhauchter Seidenschleier, durch den hier und da die gründichblaue Himmelskuppel durchschimmert. In der Brückennock sieht hingerissen unser Künstler in diese Farbensymphonie. Ich nicke ihm zu, er schüttelt den Kopf: „Toll, einfach toll!“ ist alles, was er sagen kann. Ganz still ist es auf der Brücke geworden, zu beeindruckend ist dies Schauspiel, das Himmel, Meer und Berge dem entzückten Auge in dieser Abendbeleuchtung bieten. Ein buntes, wenig bekanntes Bilderbuch der alten germanischen Sagen kommt in den Sinn, ein Bild der Waberlohe und der Götterdämmerung in diesem Buch, das man oft betrachted, weil diese unwirklichen Farben, die auch die See widerspiegelte, auf der ein Wikingerdrachen der Küste zustrebte, so beeindruckend wirkten. Genau so steht jetzt die norwegische Küste in einen Feuerbrand, der von Stunde zu Stunde flammender, unvergeßlicher wird. Hinter den niederen Schären taucht eine Stadt auf. Häuser, am Berghang hingeschmiegt, hinter höheren Inseln die Stadt selbst, Schiffsmasten, Dampferschornsteine: Vorne, auf gischtumsprühter Schäre ein Leuchtturm, kleine Leuchtfeuer auf winzigen Riffen zur Seite, und im Hintergrund Berge, ein Höhenzug hinter dem anderen, von denen der letzte und höchste dunkelblau und starr wie eine Felsmauer die Szene schließt. Vor der Einfahrt dampfen Fischdampfer, deutsche Vorpostenboote, schwarz im Schatten der Küste. Ein
altes norwegisches Torpedoboot, seltsam anzuschauen mit weit auseinanderstehenden Masten, niederem Bord und qualmendem Schornstein läuft auf gleichem Kurs wie unser Verband. Von der Torpedobootsbrücke winkert ein Signalgast: „K. an K.: Heil und Sieg und fette Beute!“ Unser Kommandant läßt ein Dankwort hinübermachen, der Kleine bleibt zurück, schlingert leicht in unserem Kielwasser und schwindet achteraus, bis nur noch eine breitgelagerte Rauchwolke geblieben ist, die noch lange sichtbar bleibt. Immer phantastischer wird die Beleuchtung, es ist kurz vor Sonnenuntergang, wie feurige Bänder schweben grellrote Wolkenstreifen über den Bergen, noch einmal flammt die See wie flüssiges blutrotes Gold, dann senkt sich langsam die Dämmerung herab, in der immer noch unsere schnellen Jäger und Zerstörer, Heinkel-Flugzeuge und Seeaufklärer rund um die beiden Schiffe herum ihre Motoren dröhnen lassen. Der Kommandant sieht angestrengt durch sein großes Nachtglas. An Backbord ist irgend etwas in Sicht gekommen, das in der tiefstehenden Sonne blinkert und blitzt: „Was ist das? Ein U-Bootsturm?“ Nun richten sich viele Gläser in die vom Kommandanten angegebene Richtung. Noch kann man nicht unterscheiden, was da eigentlich die letzten Sonnenstrahlen auffängt und zurückwirft. „Kann eine Tonne sein. Es schwingt so auf dem Wasser – nein: jetzt ist es deutlich auszumachen, ein Fischerboot!“
Der nasse Bootskörper leuchtet jedesmal silbern auf, wenn das Boot im Seegang sich heraushebt aus dem Wasser, und in diesem weißgemalten Schiffsrumpf spiegeln sich die nun fast waagerecht hereinfallenden Strahlen der untergehenden Sonne. Ein bißchen schuldbewußt sehen die Männer vom Ausguck den Kommandanten an: „Es ist nicht schön, wenn der Alte alles stets zuerst sieht,“ steht deutlich auf ihren Gesichtern zu lesen. Dieser Kommandant – das haben wir im Verlauf der Unternehmung oft genug festgestellt! - sieht aber tatsächlich „leider“ viele Dinge als erster. Und das ist auch ganz gut so. Der Kommandant hat eben an Bord nahezu unfehlar, alleswissend und allessehend zu sein! Als die Steuerbordkriegswache zur Ablösung heraufkommt, liegt im Westen noch ein korallenroter Streif als letzte Erinnerung des märchenhaften Sonnenuntergangs über der See, während über dem abgeblendeten Schiff der unvergleichlich schöne, strahlende nordische Sternhimmel mit all seiner Pracht wie ein silberbestickter Mantel sich wölbt. Gerade über dem Vormarsstand, dicht über der leise durch die sanfte Dünung hin-und herschwingenden Mastspitze leuchtet ein besonders heller und großer Stern. Man bereut es nicht, ohne Wache zu haben, oben geblieben zu sein und nun durchstehen zu müssen: diese zauberhaften Sonnenuntergänge, die man doch wahrhaftig oft genug erlebt hat, zwingen jeden, der sich den Sinn für ihre Schönheit bewahrt hat, zu stets neuer Bewunderung. Ich glaube auch, daß die von uns, die
fast verächtlich jeden ansehn, der unverhohlen ausspricht, daß ihn jeder Sonnenuntergang auf See von neuem begeistert, tief im Herzen heimlich ganz genau so denken und es nur törichterweise für „unmännlich“ halten so etwas offen zu bekennen! Inzwischen hat der Läufer Brücke aus der Kombüse Tee für die Brückenwache gebracht. Wir stehen leicht frierend umher – es ist mit dem Verschwinden der Sonne empfindlich kalt geworden – und schlürfen das heiße Getränk aus den dicken Porzellantassen. Hier in diesen Breiten wird die Morgendämmerung nicht lange mehr auf sich warten lassen, der Kriegswachleiter setzt seine Tasse klirrend auf einen der Sattelsitze hinter der Brückenreling und winkt seinen Hauptbefehlsübermittler herbei: „Hier! Geben Sie durch: die Dämmerung ist die günstigste Zeit für U-Bootsangriffe. Besonders scharf Ausguck halten!“ Der Matrose beugt den Kopf zum Sprechtrichter seines Telephons und wiederholt, dann hält er die Muschel zu und sieht den Artillerieoffizier an, der seinen ewig verrutschenden Schwimmwestenbeutel zurechtrückt und fortfährt: „Alles Auffällige ist sofort zu melden. Lieber zuviel als zu wenig melden. Die Sicherheit des Schiffes hängt vom Ausguck ab. Wiederholen!“ Es geschieht, bis der A.O. abwinkt, die dicken Handschuhe auszieht und wieder zu seiner Teetasse greift. Kurz vor drei Uhr beginnt schon das Morgenrot: fern im Osten steigt es herauf, verbreitet sich zusehends
über den ganzen Osthimmel und läßt den silbrigen Halbmond, der wie eine ins Dunkel geschnittene Laterne an Steuerbord in einer Dunstschicht über der See schwebt, in einen fast durchsichtigen zarten Rosa aufschimmern. „Abnehmender Mond,“ bemerkt der Rollenoffizier, „vielleicht ändert sich das Wetter. Heute bleibt es jedenfalls noch schön, das steht fest.“ Über dem fernen Küstenstreifen, der als blauschwarze vielgeschwungene Linie die See begrenzt, hebt sich, feurig und golden, zusehends wachsend, die Sonne. Unwillkürlich blickt alles, was an Steuerbordseite auf der Brücke steht, dorthin: „Komisch sieht sie aus,“ stellt einer der Ausgucks fest und dreht das fest eingebaute Brückenglas, hinter dem er gebückt stehend, die Kimm absuchte, ein paar Gewinde höher, „ein großer Ball mit einem aufgesetzten flachen Viereck.“ „Das ist die Strahlenbrechung in der Dunstschicht über der Küste, mein Junge!“ erklärt der Artillerieoffizier und hebt sein großes Artillerieglas. „Die Form wechselt übrigens, passen Sie mal auf-“ Immer schneller steigt die glührote Kugel hoch, verliert das Viereck auf ihrem oberen Rand und erscheint nun als orangene Scheibe, die jetzt am unteren Ende ein scharf abgesetztes flaches Viereck als Anhängsel mit hochreißt. Im Nu wechselt auch die bisher stumpfgraue See ihre Farbe: wie von innen her durchleuchtet, ziehen hellgrüne Streifen übers Wasser, das nach Osten, nach Land zu, opalen schimmert.
„Vier Flugzeuge gerade in der Sonne!“ ruft plötzlich eine Stimme aufgeregt in unsere Betrachtung hinein. Tatsächlich: vier dunkle Punkte, winzig klein, stehen im brennenden Gold, vier Flugzeuge. Sind es eigene? Englische? Unmöglich, den Typ auf diese Entfernung auszumachen. Entfernungsmeßgeräte drehen sich, suchen und beobachten. Umsonst: ebenso schnell, wie sie auftauchten, sind die geheimnisvollen Flugzeuge wieder verschwunden, ohne näher gekommen zu sein. „Wenn das wirklich Engländer waren, melden sie uns natürlich. Irgendwann müssen uns die englischen Langstreckenaufklärer ja doch finden.“ Der Rollenoffizier sagt es.- Wir schweigen. Er hat recht, unbemerkt werden wir bestimmt nicht in den Atlantik kommen. Daß es tatsächlich Engländer waren, die uns sahen und auch meldeten, erfuhren wir erst viel später aus den englischen Berichten. Augenblicklich Kümmern uns diese Flugzeuge nich viel, zumal deutsche Flugzeuge um uns sind und Sicherung fliegen. Wir recken die Köpfe zu den blitzschnellen Jagdmaschinen, die in tollen Kurven über uns hinwegschwirren, winken, hochziehen und in Sekundenschnelle weit vorne zu zweien un dreien davonstieben. Silbern glitzern ihre Tragflächen, wie flinke Libellen huschen sie bald dicht überm Wasser, bald unendlich hoch am Himmel dahin, während die Zerstörer in Ketten lang und schmal mit dröhnenden Motoren, tadellos ausgerichtet ihre Kurse steuern. „Wie Bleistifte sehen sie doch aus,“ meint ein Leutnant.
„Mich erinnern sie immer an die Garnelen, die Granat, wie man an der Nordseeküste sagt. Einen Kopf vorne mit Scheren und einen schmalen langen Leib dahinter. Finden Sie nicht?“ Granat – mein Himmel! Wie weit liegt das zurück, daß man als kleiner Junge in Borkum mit einem vom Vater geschenkten Schurrnetz barbeinig längs der kleinen Ausläufer der Brandungswellen ging und selig war, wenn wirklich ein paar dieser blassen, fast durchsichtigen kleinen Krebse sich im engmaschigen Netz, das der hölzerne Bügel auseinander hielt, fingen! Überhaupt, diese Kindheitserinnerungen! Je älter man wird, desto strahlender und schöner erscheint einem die Kinderzeit. Wie schön war es doch, mit dem Vater frühmorgens auf der ziegelroten Strandmauer nach Norden zu wandern, bis zur Victoriahöhe, wo es die herrlichen Kartoffelpuffer gab, und dann weiter zum Muschelfeld mit seinen unendlich vielen bunten Muscheln, den großen Wellhornmuscheln mit Einsiedlerkrebsen und den kalkweißen Seepocken auf der gerippten Außenhaut, den zartrosa und bläulichvioletten Plattmuscheln, den kräftigen Herz- und den bräunlichen Dreiecksmuscheln, die solch winzig feine, nadelscharfe Zähne an ihrem Rand trugen. Scheidenmuscheln, wie Samuraischwerter geformt, zerbrechliche schwanenweiße Dattelmuscheln galten schon als seltene Funde und wurden sorgfältig in Sand verpackt im Eimer Getragen. Und dann ging’s quer über das weite, in der Sonne glühend heiße Muschelfeld zum Deich, der Ost- und Westland verband. Es duftete herb und frisch nach rosa Strandnelken, bläulichvioletten
Kriechweiden und all den feinen Salzkräutern, die zwischen den silbriggrünen Stranddisteln die Dellen der Dünen zwischen Muschelfeld und Tüskendöör füllten. In der Ferne zackte die Silhouette des Dorfs mit dem hohen neuen und dem vierkanten alten Leuchtturm und den ragenden Bauten der Strandhotels. Upholm lag friedlich zwischen den Deichen, und schwarzbuntes Vieh stand im fetten Grün der Binnen- und Außenweide.- Es ist kurz vor der Ablösung und ich gehe hinunter ins Kartenhaus, nachzusehen, wo wir eigentlich jetzt stehen. Oben im Stand, aus dem gesteuert wird, führt an Steuerbordseite ein steiler Niedergang hinab zum eigentlichen Raum, der dem Steuermannspersonal zur Verfügung steht. Den Niedergang selbst schließt eine Holzgitterklappe, die für gewöhnlich den Niedergang abschließt und jedesmal hochgenommen werden muß, wenn jemand hinunter will. Neben diesem Holzgatter ist auch im Stand ein Kartentisch, auf dem immer einer der Steuermannsmaaten der Wache mit Zirkel und Dreiecken hantiert, einen der Chronometer in der Hand, die Fahrttabelle vor sich, Radiergummi und Bleistift in Reichweite. Auf diesem mahagonibraunen Tisch, über dem Sprachrohre und Telephonleitungen von Brücke, Signaldeck und Kartenhaus münden, über dem Echolote und Chronometer hängen und der für alle außer dem wachhabenden Steuermannspersonal gewissermaßen „tabu“ ist, habe ich während der Dauer der Unternehmung Film- und Photoapparat verstaut. Der Stabsobersteuermann hatte lächelnd auf meine Frage genickt
wir kennen uns von einer Friedensübung auf dem Kreuzer „Leipzig“ her und der große blonde Stabsfeldwebel ist selbst ein begeisterter Photograph! Unten im Kartenhaus, das eine Tür mit besonders hohem Süll zur Kammer des Navigationoffiziers hat, schläft die Freiwache auf den mit schwarzem Leder bezogenen Kojen, während die Wache, dicht über die von hellen Lampen bestrahlten Spezialkarten gebeugt, laufend den Schiffsort einträgt. Hier ist es endlich warm nach der morgenkalten Brücke, warm und gemütlich. Auf dem Mahagonitisch liegt, weit ausgebreitet die Spezialkarte, die den Teil der norwegischen Küste wiedergibt, vor dem wir mit unserer Gruppe gerade stehen. Es ist an der engsten Stelle, der Enge von Shetland-Bergen, und ich lasse mir von Obersteuermannsmaaten zeigen, in welchen der vielen Fjords wir einlaufen wollen. Lauter bekannte und vertraute Namen stehen bei all den Riffen, Schären und Fjords: wer zur Kriegsmarine gehört, kennt die norwegische Küste von vielen fröhlichen Friedensfahrten, von Übungen der Flotte, Sommer- und Herbstreisen her. Stumm deutet der Obermaat auf die vorgezeichnete Kurslinie und klopft mit dem Zeigefinger auf eine Stelle: „Hier ungefähr erwarten wir das Lotsenboot, Herr Kapitän.“ „Schön. Und wann laufen wir wieder aus?“ „Das ist noch nicht bekannt. Ich denke aber bestimmt heute abend noch. Wir müssen doch zusehn, so schnell wie möglich, in den Atlantik zu kommen!“ „Allerdings! Geben Sie doch mal den Stechzirkel her, bitte.“
Ich greife an der Seite die Meilen ab, die wir laufen, und übertrage sie auf unseren Kurs: „Das Einlaufen wird die Backbordwache machen. Dann können wir uns alles als Badegäste schön ansehn, großartig! Wird aber noch etwa vier Stunden dauern, bis wir die Außenschären haben, wenn wir mit dieser Fahrt weiterlaufen. Wir stehen noch ziemlich weit draußen.“ „Jawohl, Herr Kapitän.“ Zwischen Hardanger- und Sogne-Fjord liegt, tief versteckt zwischen Bergen und großen und kleinen Fjords, Bergen. Die alte Hansestadt mit den deutschen Kontoren an der Tyskebrygge, die im Mittelalter so buntes Leben bargen, wenn die Ernte der riesigen Heringszüge hereinkam. Als ich den Namen auf der Karte lese, muß ich, wie so oft , an den Unterschied denken, der diesen Krieg vom Weltkrieg scheidet. 1918 schien es uns, den jungen Offizieren in der damaligen IV. Aufklärungsgruppe ein kühnes Wagnis, als der Flottenchef die gesamte Hochseeflotte durch die unendlichen Minensperren hindurchführte und zur Unternehmung auf die Geleitzüge, die stets zwischen den Shetlands zur norwegischen Küste liefen, ansetzte. Damals standen wir mit dem Flaggkreuzer „Regensburg“ auf der Höhe von Stavanger von dem Gros und hier, wo jetzt unsere Kampfgruppe läuft, liefen in jenen Apriltagen die Schlachtkreuzer mit der II. Aufklärungsgruppe und den großen Hochseezerstörern der II. Flotille. Zum Erfolg führte dies für damalige Verhältnisse kühn ausgreifende Unternehmen nicht. Der erwartete Geleitzug hatte die Linie
Shetland-Bergen einen Tag vor unserem Erscheinen bereits passiert. Und jetzt? Heute ist es gar nichts Besonderes, daß wir hier herumfahren. Steht doch der Kriegsmarine die ganze lange norwegische Küste zur Verfügung, von Lindesmäs bis zum Nordkap und darüber hinaus bis Kirkenäs. Stavanger, Bergen, Drontheim, Tromsö, Hammerfest, Vardö: alles sind Häfen geworden, die unsere Kriegsschiffe längst kennen, Häfen, aus denen unsere Kampfgruppen auslaufen zum Einsatz gegen die feindlichen Handelswege, gegen Geleitzüge und – wenn es sich so fügt – gegen die Überwasserstreitkräfte des Engländers, die diese für die Insel so lebenswichtigen Konvois zu schützen haben oder Truppentransporte zu sichern hatten, damals als der Kampf um Norwegen tobte und die Engländer aus allen Stellen hinausgeworfen wurden von Andalsnes und Namsos bis Narvik, hoch über dem Polarkreis! Nach der Ablösung sehe ich noch einen Augenblick den wendigen, schnellen Me 109 zu, die unermüdlich ihre Steilkurven drehn und mit blitzenden Tragflächen über uns hinschwirren, den Polartauchern, die plump, mit gelben, weißgefleckten langen Hälsen wie Steine ins Wasser stoßen, tauchen und weit entfernt wieder an der Oberfläche erscheinen, den gleichen Vögeln, die uns damals 1918 auffielen, als wir hier vergeblich auf den Gegener fahndeten. Werden wir diesmal mehr Glück haben? Wir glauben es. Jeder an Bord wünscht es und darum glauben es auch alle und freuen sich auf das erste Zusammentreffen mit dem Gegner – ganz einerlei, ob es nun Dampfer eines Geleitzuges oder Kriegsschiff
sind, deren Rauchfahnen als erste über die Kimm klettern werden! Wir haben gute, schnelle Schiffe unter den Füßen, tadellose Waffen, mit denen die Waffenleiter umzugehen verstehen, ausgezeichnete Besatzungen und eine Führung, die den Gegner kennt, die nicht ausweichen, sondern rangehen und jeden Kampf aufnehmen und durchstehen wird. Diese unerschütterliche Überzeugung stärkt Selbstbewußtsein und Mut jedes einzelnen und schafft jene Kampfstimmung, jenes fröhliche Vertrauen, das so bezeichnend für den echten Soldaten und himmelweit entfernt ist von dem „würdigen Ernst“, der gerade uns, den Männern, die gegen den Feind fahren, so gerne angedichtet wird. Daß alles im Grunde sehr ernst ist, daß wir uns zu bewähren haben, daß jede Unternehmung, jede Fahrt gegen den Feind mit zum Endsieg beitragen muß und daß wir alle, jeder an seinem Posten, unserer, der nationalsozialistischen Idee und damit dem Führer zum Siege helfen müssen, das ist tief in unsere Herzen gegraben. Aber daran denken wir nicht, das versteht sich von selbst, das ist ja doch der Leitstern, nach dem wir alle steuern, wie die alten Seekönige nach dem Loadstar, wie er altnorwegisch hieß, dem Nordstern des Kleinen Bären ihre Drachen zu steuern verstanden. Und darüber reden, es immerfort erwähnen, es in unseren Briefen oder Arbeiten herausstellen – nein, das tun wir schon gar nicht. Den Glauben an eine Idee, an den Sieg einer Idee, einer neuen Weltanschauung, an Führer und Volk, den festen, unbeirrbaren Glauben hat man, aber man redet nicht von ihm –
Im Laufe des Vormittags gehen wir noch näher an die norwegische Küste heran, die von rötlich-violetten Schleiern verhängt, im Osten liegt. Schären heben sich aus der Flut, die typischen niederen weißgemalten kleinen Leuchtfeuer krönen wildzerrissene Riffe, an denen die Brandung im Swell der Dünung aufgischtet, sie bis hoch hinauf überwäscht, daß der nackte Fels naß und glatt wie ein Walrücken in rosa Farben getaucht daliegt. Mit langsamer Fahrt, „Bismarck“ vorauf, steuern wir in einen der vielen Fjords hinein, deren Wasser still und dunkelblau im Schatten der immer höher steigenden Felshügel geheimnisvoll schimmert. Alles, was dienstfrei ist, steht und liegt bei uns an Deck herum, zeigt sich die Berge, die wenigen Holzhäuser, die hier am Fjordeingang, rings an den Hängen kleben, die nur hier und da schütteres Birkengrün und vom ewigen Wind verkrüppelte Kiefern tragen. Hinter den unzähligen Inseln, Halbinseln und Buchten ragen kulissenartig hintereinander aufgetürmt hohe Berge wie blaudunstige Schatten. Auf einigen der höchsten Kuppen schimmert Schnee in breiten, rissigen Streifen, näher und näher rücken sie heran, bald unterscheidet man am Fuß der Hänge kleine Siedlungen mit buntgemalten Häusern, vor jedem steht der weiße Flaggenmast, der hier in Norwegen bei keinem Hause Fehlen darf. Ein leuchtend weißer Motorkutter puckert heran, „Steiermark“ steht in schwarzen Buchstaben am Bug, die Hakenkreuzflagge weht von einen Stag des Großmastes, ausrangierte Autoreifen hängen als Fender längsseit, und an Deck erkennen wir bald Offiziere
und Matrosen der Kriegsmarine, die zu dem langsam herangleitenden Schweren Kreuzer heraufschauen: Das Lotsenboot. Neben unserem niedergelegten Backbordbootskran legt es an, ein schnell ausgeworfenes Seefallreep poltert gegen die Bordwand, zwei Seeoffiziere klettern an Bord, grüßen und werden zur Brücke geleitet, wo sie sich bei dem Kommandanten melden. Da „Prinz Eugen“ zur Übernahme gestoppt hatte, ist „Bismarck“ inzwischen weit voraus gerade sehen wir noch die Zerstörer neben dem mächtigen Schlachtschiff eine Kursänderung ausführen, als der Kreuzer wieder Fahrt aufnimmt und folgt. Mit dem Adjutanten, einem Ingenieuroffizier, und dem Stabssignalmeister stehe ich in der Steuerbordnock der Admiralsbrücke und beobachte das Einsteuern in die inneren Fjords. Unermüdlich schwirren die leichten Jäger über das Schiff, in kühnen Kurven tanzen sie umher, winken und freuen sich offensichtlich ebenso wie die Kreuzerbesatzung an der wunderbar warmen Sonne, dem farbenfrohen Bild, das diese Einfahrt bieted, und dem Anblick dieser beiden neuen und mächtigen Kriegsschiffe, die nun mit wechselnden Kursen ihren Ankerplätzen zustreben. Ein Walfangboot passiert auslaufend, Fischdampfer gleiten, die Kriegsflagge am Heckstock, vorüber, ein Dreimastgaffelschoner, den Danebrog über dem Besansegel, steuert der Ausfahrt zu und zieht eine breit auslaufende Spur in das nun tiefblaue Wasser, das in weichen, weit wellenden Falten sich bauscht.
Ein Pfiff gellt, gefolgt vom Aussingen des Bootsmannsmaaten der Wache: „Mützen dürfen abgenommen werden!“ Himmlisch warm scheint die Sonne, windstill ist es, doppelt angenehm nach der kalten Nacht draußen. „K.d.F.-Fahrt, Herr Kapitän!“ meint der Adjutant. Es ist wie ein Traum, dieses Einlaufen, man könnte Krieg und alles vergessen, wenn nicht die überall an Land aufgebauten Flageschütze und Flawaffen, deren Bedienungsmannschaften winkend herübersehen, die harte Wirklichkeit sinnfällig unterstrichen. Auf einem der Unterbauten eines Flageschützes an Land – wenn die feldgrauen Bedienungsmannschaften nicht danebenständen und aufgeregt winkten, hätten wir es, gut getarnt, wie die ganze Batterie ist, nie bemerkt! – ruft ein Matrose dauernd den Kreuzer mit Winkflaggen an. Der Stabssignalmeister legt das schwere Doppelglas auf die Reling und liest selbst ab: „Wie heißt das zweite Schiff?“ Wir lachen. „Das möchtet ihr wohl wissen!“ schmunzelt der Adjutant. „Machen Sie doch rüber: das ist gg, ganz geheim!“ schlage ich vor. Höher werden die Felsberge, bewaldeter; kleine Gärten tauchen auf, hübsche Landhäuser, Mädchen in hellen und bunten Kleidern winken, wir mustern die Häuser und verteilen sie großmütig unter uns: „Dies möchte ich haben, sehen Sie? Da, rechts von der hohen Flaggenstange mit dem entzückenden Blumengarten und der kleinen Garage.“
Der Adjutant schüttelt den Kopf: „Nein, das nächste, das etwas höher liegt, hinter dem kleinen Birkenwäldchen und dem hellen Vorplatz mit den Gartenstühlen, das würde ich nehmen.“ „Natürlich nur wegen der drei Mädchen, die gerade aus dem Haus laufen,“ nagelt der Kapitänleutnant, der hinzugetreten ist, den Leutnant fest. „Sehen sie, jetzt winken sie alle drei! Hallo! Skol, vakke Pigge!“ ruft er, zieht die Bordmütze, die er unter den Arm geklemmt trug, hervor und winkt vergnügt. „Ihr Norwegisch ist doch man sehr mangelhaft,“ rächt sich der Adjutant, „mit Skol und vakke Pigge werdern Sie die nicht betören!“ Es ist ein entzückendes Bild, diese stille Alpenseelandschaft, das tiefblaue Wasser, die hellgrünen Büsche an den Hängen, die silbernen Birken, die weiß oder ochsenrot leuchtenden Häuschen, offenbar Sommersitze reicher Bergener Kaufleute, die hohen Bergzüge im Hintergrund, auf deren Kuppen der letzte Winterschnee in der Sonne strahlt. Alles ein Bild tiefsten Friedens mitten im Kriege. Rührend anzusehn ist auch, wie auf unseren Außendecks, überall dort, wo die Sonne warm auf den Holzplanken liegt, die Blumentöpfe aus den Kammern hingestellt werden, die armen Blumen, die beim abgeblendet Fahren statt Licht und Luft Zigaretten- und Zigarrenqualm zu schlucken haben und trotzdem, von ihren Besitzern sorgfältig betreut, lichtes Grün und bunte Farben zwischen Eisenwände, Uniformschränke, Dienstbücher und Aktendeckel zaubern.
„Bismarck“ ist vor uns zu Anker gegangen, riesenhaft wirkt das lange, turmbewehrte Schlachtschiff, aus dessen breitem Schornstein eine dünne weiße Ölwolke senkrecht vor dem grüngrauen Hintergrund der Felsenberge gen Himmel steigt. Mit ausgebrachten Fallreeps, den grauen Stahlleib von Tarnstreifen zerschnitten, von kleinen Norwegerbooten umgeben, ruht das Flaggschiff, an dessen Decks ebenso wie bei uns die Männer die warme Sonne und die von Kiefernduft und Seesalz gesättigte Luft genießen. Winksprüche gehen von Brücke zu Brücke, wir laufen weiter, in einem anderen der gerade hier vielverzweigten Fjords unser Öl zu ergänzen. Langsam gleitet die norwegische Landschaft vorüber. Nacktes Felsgestein, kleine Inseln, deren zerrissene Felswände auf ihrer Höhe ein, zwei kleine Holzhäuser tragen, neben denen der Flagstock ragt, wechseln mit bewaldeten Höhen, an deren Fuß Häusergruppen über schmalen Landestegen windgeschützt kauern, und immer ragen stumm, blaulila im Vormittagsdunst hohe Bergzüge mit kahlen, schroffen Graten und fernen Schneefeldern als Abschluß dieser aus See, Fels und Fjord gestalteten Welt. Endlich liegt auch der Schwere Kreuzer in einer stillen Bucht zu Anker, hat seine Öldampfer längsseit und beginnt mit der Ölübernahme. Ich gehe mit dem Leitenden Ingenieur über die Schanz, die jetzt, bei niedergelegter Reling die vom Ersten Offizier befohlenen weißen Randstreifen trägt. Leise knarren die dicken Manilaleinen, mit denen die Dampfer festmachten; heiß strahlt die Sonne, wir nehmen die Bordmützen ab und klemmen sie unter den Arm.
„Wie ein Alpensee, genau wie ein Alpensee!“ ruft der Korvettenkapitän und zeigt mit der Hand auf die weite glitzernde, rings von niederen Höhen umgrenzte Wasserfläche. „Auch die Farben sind genau so: dies Enzianblau und das Dunkelgrün bei den kleinen Büschen auf den Inseln drüben, die hellen Birken und die bunten Häuschen.“ Ich stimme zu: „Nach dieser Seite ja, aber sehen Sie mal rüber nach Steuerbord, drüben sieht die Geschichte schon anders aus, da wo der deutsche Dampfer zu Anker liegt und die weißen Boote längsseit hat. Das sieht aus, als sei direkt dahinter die See, und die Felskuppen sind alle nach einer Seite gerichtet, wie die Bäume auf unseren Nordseeinseln, die der ewige Westwind gebeugt hat. Das ist die reine norwegische Felsküste.“ Langgestreckt, nackt und kahl, von wenigen, auf schmalen Felsgrat stehenden Häusern gekrönt, zieht sich drüben die Felslandschaft hin. Man glaubt die Brandung zu hören, die auf der anderen Seite zwischen Schären und Riffen aus der freien See anrollen muß. Ein Wall scheint dies niedere Land, eine Sturmmauer gegen das Wehen aus Westen, vor dem es den stillen Alpensee zu schützen hat, in dem wir jetzt liegen. Braun und grau, rissing und wie mit tausend Sorgenfalten durchzogen, reckt das Granitgestein sein zerschrundenes Gesicht der wärmenden Sonne zu. In der Nähe haben zwei unserer Zerstörer geankert, hellgrau gemalte Minensuchboote kreuzen in der weiten Bucht, Vorpostenboote laufen aus, und zwischen den
Inseln tauchen zuweilen hell leuchtende Segel norwegischer Fischerboote auf. Es ist ein wunderbar klarer, sonniger Tag, der uns hier vergönnt wird, und wir alle fühlen instinktiv, daß dies eine gern empfangene kleine Pause vor dem großen Geschehen, ein Geschenk des Schicksals darstellt, das uns allen vor dem Kampf draußen eine kurze Entspannung bringt. – Am späten Nachmittag bezieht sich der Himmel mit schweren blaugrauen Wolken. Wind kommt auf, die Wasserfläche beginnt sich zu kräuseln unter den Böen, die von See her über die Felsgrate hereinbrechen, die Flaggen steif auswehen und die bisher an Deck in der Sonne liegenden Männer schleunigst unter Deck verschwinden lassen. In der warmen Kammer hole ich das schwarze Notizbuch aus der Schublade und notiere ein Gespräch, das ich mit dem M.I., einem Kapitänleutnant, vor wenigen Stunden auf der sonningen Schanz auf und ab gehend, hatte. Der Diplomingenieur ist bei der Eroberung des norwegischen Kriegshafens Horten mit dabei gewesen, trägt das Eiserne Kreuz und kann wundervoll erzählen. Der Handstreich, die Eroberung des Hafens und die damit verbundenen Ereignisse sind mir bekannt. Es ist eine Episode aus dem an tapferen Einzeltaten, an unerhört kühnen Unternehmungen so reichen Kampf um dies Land. Kaum jemand weiß, daß ein einziges Räumboot, geführt von dem für diesen Erfolg mit dem Ritterkreuz ausgezeichneten Stabsobersteuermann Godenau zunächst allein mit einer Handvoll tapferer Männer des Heerer und der Kriegsmarine unter Führung des
Oberleunants und ehemaligen Hitlerjugendführers Budäus und des Flottilleningenieurs, Kapitänleutnant (Ing.) Grundmann, die beide ebenfalls mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet wurden, Stadt und Kriegshafen Horten, an der Westseite des Oslofjords gelegen nahmen. Jene drei Namen stehen richtungsweisend über der Tat, sind seit jenem kalten, dämmerigen Aprilmorgen ins Buch der Geschichte geschrieben: der Räumbootskommandant als Vertreter der Kriegsmarine, der Heeresoffizier und der Flottilleningenieur als Stoßtruppführer, ersterer als Leiter der Operationen an Land. Voller Einsatz, kühner Angriff und kluge Umsicht haben den unglaublichen Erfolg der kleinen Schar erringen helfen, nachdem das Räumboot selbst von norwegischen Kriegsschiffen in Brand geschossen und vernichtet war. Unser M.I. hat dann später die Einrichtung der großen Marinewerft Horten, ihre Sicherstellung für die Zwecke der Kriegsmarine durchzuführen gehabt: „Wissen Sie, es war sozusagen ein Arbeiten mit Bordmitteln. Das schlimmste waren die Arbeiterstreiks, die Geldbeschaffung und all das, was verwaltungsmäßig zunächst aus dem Nichts geschaffen werden mußte. Es gab anfangs eigentlich nur Schwierigkeiten, und ich hätte nie gedacht, daß mir die Aufgabe in so kurzer Zeit glücken könnte. Aber wir haben’s geschafft, natürlich haben wir’s geschafft! Vorpostenboote habe ich ausgerüstet, in Dienst gestellt, repariert und klar gemacht. Als es dann glücklich in Gang kam und lief, mußte ich natürlich wieder fort und ein anderer setzte sich ins wohlvorbereitete Nest. Aber Spaß hat’s doch gemach
es war ein herrlich selbständiges Kommando, und das möchte man ja doch immer am liebsten haben!“ Abends, nach dem Abendessen ist es dann so weit: wir laufen aus. Da der Himmel völlig bedeckt und von regenschweren, dunkelgrauen Wolken verhängt ist, die eilig vor dem starken Wind mit schweren Bäuchen dicht über den Kuppen der Berge treiben, lasse ich – leider! – Film- und Photoapparat in der Kammer und gehe im Mantel an Deck. Wir steuern durch einen breiten, langgestreckten Fjord, dessen mürrisch graue Wasser zu kurzem Seegang aus ihrer Ruhe aufgestört mit Schaumstreifen vor dem Südost dahinwandern. Von aufgischtender Brandung umspülte Schären säumen vor Nässe gläzend das breite Fahrwasser, das schwere Bergklötze wuchtig und schweigend umgeben. Zu Nebel verdichteter Dunst füllt mit grauen, wehenden Schleiern die Schluchten zwischen den Felsmassen und hüllt breit gelagerte Berghäupter völlig ein. Während „Bismarck“, an Backbord uns überholt, um sich wieder an die Spitze zu setzen, preschen an Steuerbord in nächster Nähe die drei schlanken grauen Zerstörer nach vorne. Wild wirbelt ihr Kielwasser, wahre Schaumkaskaden stürzen hinter den schmalen Hecks hoch und verlieren sich in quirlenden, tanzenden grünweißen Kreisen im Stumpfgrau des Fjordwassers, das die Schrauben der Boote aufreißen. Unter den dunkelgrauen Wolkenleibern hängen schwarze Striche auf farblosem schwerem Vorhang: die Me 110, die unser Auslaufen sichern. An Steuerbord, eng geschmiegt an den
grauen Felsen überragt vom spitzen Turm einer Holzkirche, sucht eine kleine Ortschaft Schutz vor dem unfreundlichen, kalten Wind. Vor uns taucht an Backbord, hochragend, mit seltsam gewinkelten schwarzweißen Tarnstreifen über und über bemalt, ein größerer Dampfer – wohl ein Sperrbrecher – auf, der rasch näher kommt. Mit schwarzem, schwerem Rauch über dem hohen Schornstein rauscht er vorüber. Von seiner Brücke beobachtet der Kommandant, das große Doppelglas vor den Augen unseren Kreuzer, von der Reling winken Männer der Sperrbrecherbesatzung unseren Männern zu. Es ist eine seltsame Stimmung, die über dem ganzen Bild liegt. Eine Stimmung, wie sie auch die Nordsee so oft widerspiegelt, wie sie heimisch ist in unseren nordischen Meeren, an unseren Küsten, die der stete Seewind umbraust, die so wenig Sonne und so viel Sturm und Regentage haben. Andere würde der graue Himmel, das graue ganze, eintönige Symphonie dieses trostlosen stumpfen Grau vielleicht bedrücken, sie mut- und lustlos machen, ihnen wie Blei schwer und drosselnd auf der Seele liegen: wir sind diese Farblosigkeit, diese weichen. Töne in einer harten, heroischen Landschaft gewohnt. Uns scheint dieser Fjord, diese sich weiter und weiter zum Meer hin öffnende Felslandschaft das breite, eherne Tor zu meerweiter Seefahrt, zur silbernen, lockenden Ferne, zu Kampf und Sieg. Hier, über die gleichen Gewässer tanzten die hochbordigen schwarzen Hansekoggen, den geschweiften
dicken Leib voll wertwoller Schiffslast, hier stampften die schlankeren Fredekoggen, die Kriegsschiffe mit den langauswehenden Wimpeln und Wappenflaggen unserer Hansestädte über dickbauchigen Segeln und kurzen Kanonenrohren, die in langen Reihen aus geöffneten Geschützpforten drohten. Hier, genau den gleichen Weg furchten auch die schmalen Drachenboote unter Sigvaldis, des Jomsburgwiking Befehl, das eisklare Wasser. Vom fernen Arkona, vor dessen Steilhang die Jomsburg mit Wehrtürmen and Häfen im Wasser stand, kamen sie und steuerten zur letzten Schlacht der Schwertbruderschaft zur Hjörungabucht bei Lid Vaag, dem heutigen Jörundfjord, südlich Aalesund. Buntfarbige Segel bauschten sich über den Helden, den berühmtesten Schwertbrüdern jener kampferfüllten Zeit. Noch ahnt keiner das Verhängnis, das die Wetterfrau, die Riesin, ihres norwegischen Gegners Verbündete, mit Blitz, Hagelschlag und Sturm den Jomsburgern bereiten wird! Heute wie damals ist der Himmel verdunkelt, ziehen Wolken über den Felsbergen hin: Wodans Wolkenhut! Windstöße heulen von den Bergen herab zu Tal, fegen Schaum aus dem Fjord, werfen einen kurzen, steilen Seegang auf und lassen dort, wo der Fjord zum Meere sich öffnet, Himmel und See in eins verschwimmen. Kampf- und Seefahrt, Heldentum und Seefahrergeist atmet diese Landschaft. Jedesmal, wenn man diese Urwelt, diese untrennbare Einheit von See und Fels, dies harte norwegische Küstenland sieht, das feuchtglänzende kahle Gestein, das kalte, schäumende Wasser, die Nebelstreifen um die Schären, die flatternden Wolkenfetz
um die fernen Berge – tauchen übermächtig die alten Götter aus dem Schoß der Urzeit. Dieser graue Abend, dies graue Meer, in das die Kampfgruppe hineinsteuert, die Schären und Granitberge, die bald im Dunst der Küste achteraus verschwinden, die alten Sagas schwertfroher Wikingerzeit: alles scheint mir so und nicht anders zu unserer Fahrt zu passen, die dem goldverblendeten Lande und seinen Helfern gilt. Ein weiser Spruch aus dem Havamal steht unsichtbar über den schweren Regenwolken: „Heulende Wölfe voraus, dunkle Raben hinterdrein: unter solchen Zeichen gehst du siegesfroh in den Kampf.“ – Die Nacht zum Himmelfahrstag findet die Kampfgruppe mit achterlichem Wind – während der ganzen Unternehmung herrschte achterlicher Wind! -, sehr bedecktem Himmel und diesiger Kimm nordwärts laufend. Eine fahlhelle Nacht, grau in grau, die Mitternachtssonne verbirgt sich hinter immer neu nachdrängenden Wolkenkulissen. Dunkel wird es von diesem Tage an überhaupt nicht mehr. Die drei Zerstörer laufen noch beim Flaggschiff, kaum zu erkennen in der feuchtkalten, diesigen Luft. Der schlanke kleine Graf, Erster E-Meßoffizier [Oberleutnant zur See Graf von Matuschka] an Bord, zieht die Bordmütze fester über den Schädel. „Dies ist doch kein Nordmeer hier!“ meint er entrüstet. Der A.O. dreht sich ein wenig auf seinem Stammplatz, einen der Sattelsitze hinter der Brückenreling: „Wieso? Glauben Sie, uns würden hier gleich die Eisbären umspielen? Warten Sie mal ab, Eis kriegen wir
auch noch zu sehen, mehr wahrscheinlich, als uns lieb sein wird!“ – Schweigen. Jeder denkt an die Streitkräfte, die der Engländer noch hier oben haben kann, wir wissen, daß alles, was für den Briten verfügbar ist, wahrscheinlich im Mittelmeer steckt oder dorthin beordert wurde, seit die Kämpfe in Griechenland und der Rücktransport der englischen, australischen und neusseeländischen Truppen einsetzte. Viel kann er also nicht mehr in Scapa haben, zumal er ja auch neuerdings Schlachtschiffe und Schwere Kreuzer zur Deckung der kanadischen Geleitzüge im Atlantik einsetzt. Außerdem ist es uns wirklich ziemlich egal. Wir werden uns schon durchschlagen. Das ist im Grunde die Meinung jedes einzelnen, der sich überhaupt Gedanken macht, und die Stärke der englischen Flotte und den Kampfwert der eigenen Schiffe kennt. Sind nicht seit vorigem Jahr mehrmals unsere Kleinen Kampfgruppen, ja sogar einzelne Schiffe zum Handelskriegs ausgelaufen, durchgebrochen und wieder zurückgekehrt? Ist es nicht gerade das Entscheidende dieses ganzes Krieges, zu Lande, zu Wasser und in der Luft, daß klug überlegte Planung und unbekümmertes kühnes Rangehn an den Feind Erfolge erzwang, die gewiß niemand vorher für möglich hielt? – Zwei Stunden vor Mittag kommt endlich die Sonne durch die Wolken, gleich wird es angenehm warm, die Beleuchung wechselt aus stumpfem, bleiernem Grau in lichtere Farben, hellgrün schimmert das Kielwasser, über dem unbekannte schwarze Vögel, vielleicht eine nur hier oben vorkommende Taucherart, schweben.
Aus dem Schornstein der „Bismarck“ steigt schwarzer Ölqualm. Gleich winkt der A.O. einen der Signalgasten heran: „Hier, machen Sie rüber: Kriegswachleiter an Kriegswachleiter, hat bei euch der Koch die Bratskartoffeln anbrennen lassen oder warum qualmt ihr so schwarz?“ Noch ehe der Winkspruch abgegeben und drüben verstanden ist, hört das Schwarzqualmen auf. Ich warte die Antwort auf den Winkspruch nicht ab, sondern steige hinunter ins Kartenbaus, nachzusehen, wo wir jetzt stehen. Bereitwillig zeigt der Navigationsoffizier [Korvettenkapitän Wilhelm Beck], der aus seiner Kammer tretend mich begrüßt, den Schiffort. Wir sind auf der Höhe von Island und Kreuzen den Weg, den rund hundertfünfzig Jahre vor der ersten Jahrtausendwende 861 Gardar Svafarsson, der Norweger, segelte, der Entdecker Islands. Zehn Jahre später begann die Besiedlung der weltfernen Insel durch die Männer, die durch König Harald Harfagr und das Christentum aus ihrer Heimat Norwegen vertrieben wurden. „Weiter südlich ist rege englische Fliegertätigkeit beobachtet worden,“ sagt der N.O. „Ich habe es dem Kriegswachleiter schon melden lassen. Guter Ausguck ist alles. Jetzt, wo leider die Sonne wieder durchgekommen ist, sehen sie uns bestimmt eher als wir sie.“ Der Korvettenkapitän fährt mit der Hand durch sein rotgelocktes, dichtes Haar, seine blauen Augen lachen: „Bis jetzt haben sie uns noch nicht wiedergefunden!“ Wir sprechen ein wenig über die mutmaßliche Verteilung der englischen Überwasserstreitkräfte, über die Kurse, die der Verband steuert, und die Wahrscheinlichkeit,
draußen im Atlantik, auf die Geleitzüge zu stoßen, die unser Ziel sind. Wir kennen uns, der N.O. und ich. Auf dem alten Linienschiff „Hessen“ waren wir zusammen, zwölf Jahre ist das nun schon her. Der N.O. ist außer dem Kommandanten – und in gewisser Weise auch dem Ersten Offizier – der einzige Offizier an Bord, der, solange das Schiff sich auf Kriegsmarsch befindet, eigentlich niemals zum Schlafen kommt. Fast ohne Unterbrechung steht er auf der Brücke, ist immer zur Verfügung des Kommandanten, sozusagen als dessen „Stabschef“, seine kurzen und seltenen Ruhepausen muß er sich geradezu stehlen, tagsüber, wenn die Sicht gut ist und nichts Besonderes erwartet wird, wenn die Lage vollkommen klar erscheint und keine Überraschungen auftreten können. Und selbst dann reicht es meist nur zu kleinen Ruhepausen, die der N.O. angezogen auf der Koje zum Schlafen ausnutzen kann, immer auf dem Sprunge sofort heraufeilen zu müssen, um auf der Brücke zur Verfügung zu stehen. Wie der Korvettenkapitän es fertigbachte, während der ganzen Unternehmung – abgesehen von einem langsam sprießenden rötlichen Bart! – frisch zu bleiben, stets auf jede Frage liebenswürdig und eingehend zu antworten, ist mir ein Rätsel geblieben. Daß er, wie der Erste Offizier auch, niemals rauchte und keinen Tropfen Alkohol trank, ist kein Grund. Der Kommandant rauchte und nahm gewiß auch hier und da ein Glas und blieb, trotz der ungeheuren, auf ihm mehr als auf allen anderen lastenden Verantwortung genau so frisch, und wir anderen, die wir immerhin auf Kriegsfreiwache schlafen konnten, soweit kein
Alarm uns aufscheuchte, rauchten gerade, um uns wach und lebendig zu erhalten!- Anderthalb Stunden nach dem Mittagessen gellen langgezogen, schrillend, markerschütternd die Alarmglocken durch den Kreuzer. Die Kriegsfreiwache, die Ruhe hatte, stürzt an Oberdeck, an die Geschütze und auf Alarmstationen. Von der Admiralsbrücke, auf die ich eile, ist nicht viel zu sehen, es ist wieder sehr diesig und unsichtig, vorne steht nur die „Bismarck“, die Begleitzerstörer sind fort. Die See ist unruhiger geworden, ab und zu schlägt die Dünung klatschend gegen den Bug und wäscht hochwuchtend über die Back. „Was ist denn eigentlich los?“ Der Signalmaat legt die Signalkladde aus der Hand: „‚Bismarck’ hat Flaggensignal gemacht: U-Boot voraus und gleichzeitig Fliegeralarm.“ „Sehen Sie etwas?“ „Nein, Herr Kapitän.“ Alles sucht mit den Gläsern die Kimm ab, weder ein U-Bootssehrohr noch ein Flugzeug sind zu entdecken, allerdings wird es zusehends unsichtiger. Ich gehe zur Brücke hinunter, mache dem Kommandanten, der groß und schweigend in der Backbordnock lehnt, meine Ehrenbezeugung und frage den Ersten Artillerieoffizier, der die Klarmeldung der Artillerie entgegengenommen und dem Ersten Offizier gemeldet hat. „‚Bismarck’ hat Schraubengeräusche eben an Backbord gehört,“ erklärt der Korvettenkapitän, „jetzt ist alles wieder ruhig. Das Flugzeug ist von uns nicht beobachtet worden ‚Bismarck’ had es anscheinend auch
nur für ganz kurze Zeit gesichtet. Ich halte es für sehr fraglich, daß der Engländer uns überhaupt bemerkt hat, falls wirklich einer da war. Bis jetzt deutet nichts darauf hin.“ Der Rollenoffizier, gleichzeitig Gefechtswachhabender und Wachoffizier der Steuerbordkriegswache lächelt: „Na, unsere Männer vom Horchgerät haben bestimmt bereits Eselsohren bekommen. Ein Spaß ist das nicht, dauernd diese Geräte zu bedienen. Sie haben aber auch nichts mehr feststellen können.“ Als der Befehl: „Steuerbordkriegswache Ruhe!“ durch alle Telephone und Sprachrohre gegeben wird, verschwinden wir schleunigst, den so jäh unterbrochenen Schlaf nachzuholen, und eilen über die lange Laufbrücke nach achtern, das Feld dem II.A.O. [Kapitänleutnant Paul Schmalenbach] als Leiter der Backbordkriegswache überlassend. Oben werden sie schon aufpassen, die Kameraden, all die Ausguckposten auf den Brücken, an den Geschützen, Ausstoßrohren und Flawaffen, die Unteroffiziere und Offiziere, denen jetzt die Sicherheit des Schiffes anvertraut ist. Ganz gewiß. – Auf der Abendwache ist es noch diesiger geworden. Das Eisendeck des Laufgangs, der an der Flugzeughalle vorbei an Steuerbord nach vorne führt, glänzt vor Nässe. Die Männer an den Schweren Flageschützen und Flawaffen haben die Mantelkragen hochgeschlagen und stehen fröstelnd umher. An den Windschächten, die breit und vergittert aus Heiz- und Maschinenräumen nach oben führen, lehenen dicht zusammengedrängt Männer der Freiwache des technischen Personals, die Luft schöpfen
und die Lage peilen wollen. Sie grüßen und machen Platz, als ich mit meinen Apparaten mich durchdränge. Einer, klein und dunkelhaarig, das gelbe Zahnrad der Techniker auf dem linken Oberarm, tritt ein wenig vor: „Sinn mer all im Eismeer, Herr Kapitän?“ Ein Rheinländer! „Na, so ungefähr, jedenfalls am Südrand. Da wir nördliche Kurse steuern, kommen wir immer mehr rein. Wo wir genau jetzt sind, muß ich selbst erst oben nachsehen. Jedenfalls ist dieses Wetter sehr günstig für uns.“ Der Matrose nickt und wendet sich seinen Kameraden zu: „Ich hann et ja jessach: dä Engländer find’t uns nich!“ Das denke ich auch, als ich weitergehe, den Duft frisch gebackenen Brotes in der Nase, der aus der Bäckerei aufsteigt. Bei den beiden steilen Niedergängen, die neben den steuerbord vordersten Schweren und Leichten Flak zur Brücke führen, schlägt der von unten hochsteigende Fahrtwind Mantel und Ölmantel hoch und zerrt an der Bordmütze. Ekelhaft naßkalt ist es heute, das Deck glitschig und glänzend, und der Wind bläst mit höhnischem Pfeifen von allen Ecken um den Leitstand. Ich höre zu, wie der II.A.O., Kriegswachleiter der Backbordkriegswache, dem Ersten Artillerieoffizier die Kriegswache übergibt. „Die Sondermeldung haben Herr Kapitän wohl gehört?“ „Nein, vertell, vertell!“ Der II.A.O. zieht einen Zettel aus der Manteltasche und überreicht ihn dem A.O. Der winkt uns heran:
„Hört zu, Kameraden! Also, das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt: Im östlichen Mittelmeer erzielte am heutigen Tage die Luftwaffe im Kampf gegen die britische Flotte besondere Erfolge. Durch Bombenvolltreffer wurden vier britische Kreuzer und einige Zerstörer versenkt, ein Schlachtschiff und zwei weitere Zerstörer schwer beschädigt.“ Er gibt den Zettel zurück: „Hoffentlich erscheinen wir auch einmal als Sondermeldung, was?“ Niemand an Bord ahnt, daß wir bereits zwei Tage später tatsächlich den Grund zu einer Sondermeldung gaben, bei der allerdings aus militärischen Gründen der Name unseres Schweren Kreuzers zum Schmerz der ganzen Besatzung nicht erwähnt werden konnte. Dann sind wir von der Steuerbordkriegswache, nachdem die Ablösung durchgeführt ist und die Schritte der nach unten eilenden abgelösten Wache verklungen sind, wieder allein auf der Brücke. Der A.O. in schwarzer Lederhose und Lederjacke hockt auf einem der beiden Holzsitze hinter der Reling. Der Rollenoffizier im schweren Wachpelz, die Bordmütze schief überm rechten Ohr, einen weißen Schal um den Hals, das schwere Nachtdoppelglas vor der Brust, lehnt wie immer am Stand, neben ihm einer der Sonderführer, alter Handelsschiffskapitän im feldgrauen Mantel, der lange, schlanke Scheinwerfer- und B.Ü.-Offizier steht neben dem Ausguckposten in der Steuerbordnock, und die beiden Hauptbefehlsübermittler sitzen wie immer auf der Holzgräting. Bei seinen Torpedoapparaten, abgesondert in
der schmalen Wanne an Backbord, spricht der Torpedooffizier mit seinem B.Ü., gibt Befehle an die Wache bei den Ausstoßrohren unten an Deck durch und beobachtet, ebenso wie wir, laufend nach vorne und den Seiten. Auf der Plattform, die zum Eingang des Gefechtsmastes führt, lehnen zwei unserer Fliegeroffiziere an der Reling und palavern mit dem Photomann der Kriegsberichter, während unser Maler mit dem Wortberichter hinter dem Stand auf- und abschreitet. Von achtern kommend, melden sich Feuerwerker und vier Fähnriche beim Kriegswachleiter auf Wache und abgelöst. Der Korvettenkapitän gleitet von seinem Sattelsitz: „Also, Feuerwerker, die üblichen Ronden. Und hier die Fähnriche, ihr seid meine Wachhunde, verstanden! Ihr paßt auf, daß überall die Ausgucks auch tadellos funktionieren und sich nicht irgendwo hinter einem warmen Luftschacht verholen. Jetzt, wo es dauernd hell bleibt, darf natürlich geraucht werden. Los, ab dafür!“ Die Fähnriche verschwinden, während der Feuerwerker noch schnell in den Stand geht, vom Steuermannsmaaten der Wache den Schiffsort zu erfahren. Ich rufe den einen der Fähnriche, einen blonden, stets vergnügt dreinschauenden Jungen zurück. Er ist Schulfreund meines eigenen Sohns und ich frage ihn nach seinen Eltern. Dann geht er den anderen nach, gerade, schlank und unbekümmert. Ich habe noch oft an diesen netten Fähnrich denken müssen, der die ganze Unternehmung so interessiert mitmachte und dem, trotzdem er Baufähnrich
war, alles, was mit Seefahrt und Borddienst zusammenhing, solch besondere Freude machte. Er ist später bei anderer Gelegenheit gefallen und ich war ehrlich erschüttert, als ich die Nachricht erhielt, wie man stets den Tod von Kameraden, mit denen man gemeinsam ein Gefecht erlebte, besonders schmerzlich betrauert. Eine seltsame Stimmung liegt heute über allem. Man weiß nicht recht, woran es liegt, ist es das fahle, diffuse Licht, das alles in ein stumpfes, seelenloses Grau taucht, ist es die Stille ringsum? Die Nässe, die Kälte, der Nebel, zu dem sich allmählich der über dem Wasser liegende Dunst verdichtet? Unheimlich dunkel und fahl, in einer Beleuchtung, die gespensterhaft wirkt, glänzt die lange Back, liegen die Decks, man hat das Gefühl, als glitte der Verband wesenlos, von irgendeiner geheimnisvollen Macht getrieben, losgelöst von allem Lebendigen, durch eine grenzenlos scheinende, unirdische Welt. „Bismarck“ ist kaum noch zu erkennen, das Flaggschiff steht wie ein großer Schatten, dessen Umrisse mit der umgebenden Nebelluft verschwimmen, vor uns. Langsam schleichen die Stunden, nichts ereignet sich. Im Leitstand hat sich der Navigationsoffizier [Korvettenkapitän Wilhelm Beck], ans Ruder gestellt, hat die Hände auf die drei Steuerknöpfe gelegt und steuert nun, den Rudergänger neben sich, den Kreuzer. „Man soll in der Übung bleiben,“ meint er, „außerdem macht’s mir Spaß, und es ist auch gar nicht schwer.“
„Ja, wenn man Gefühl dafür hat!“ werfe ich ein. „Mancher lernt es nie und kann noch solange am Ruder stehn.“ Das rote lockige Haar des Korvettenkapitän leuchtet, er hat die Bordmütze abgelegt, steht breitbeinig da und hält mit kleinen Verbesserungen die „Prinz Eugen“ haargenau im Kielwasser des Vordermanns. „Erik der Rote am Ruder seines Drachen!“ bemerke ich „Der ist hier gefahren, der alte Totschläger, der später sogar von Island nach Grönland segelte und dort die ersten Wikingersiedlungen gründete. Wir laufen dauernd auf den Spuren dieser Norweger. Schade, daß man das unsern Männern nicht mal erzählen kann, die meisten wissen das sicher gar nicht.“ Der lange B.Ü.-Offizier hat mit Hilfe des Sieders des A.O. Kaffe gekocht, richtigen, starken Kaffe, den wir, die kalten Hände um die großen weißen Porzellantassen gelegt, langsam trinken. „Morgen bin ich dran mit Kaffe, mein Lieber!“ meldet sich der Artillerieoffizier. „Meine Mammie hat mir echten mitgegeben und den werden wir so langsam verdrücken auf unseren Wachen, bis er alle ist. Friebe, bring dem Kommandanten mal ’ne Tasse raus. Der friert genau so wie wir!“ Friebe ist der Haupt-B.Ü. des A.O. Ein Gesicht wie ein Seeräuber: verwegen, braungebrannt, scharfe Adlernase, dunkelbraune Augen. Als mich dieser Mann zum erstenmal auf der Brücke grüßte, fiel er mir sofort auf: „Mensch, wenn man Ihr Bild in eine englische Illustrierte Zeitung brächte, dann schrieben sie gewiß
drunter: ‚Der Nazihunne’! Wie heißen Sie und was sind Sie für’n Landsmann?“ „Friebe, Herr Gabidän, aas Sochsen.“ „Das hört man!“ Ein tadelloser Mann, dieser B.Ü. Auch im Gefecht hat er sich, dessen erstes Gefecht jener Kampf in der Dänemarkstraße zwei Tage später war, ausgezeichnet gemacht. Der Kommandant erzählte mir, daß er, als die Wogen der Begeisterung allzu laut und hoch gingen, mehrmals, als sei das ein Befehl des Kommandanten selbst, Ruhe gefordert und lauthals durch sein Kopftelephon geschimpft hat. Mit Erfolg! Hinter dem B.Ü., der die hochgefüllte Tasse vor sichtig trägt, gehen wir wieder auf die Brücke hinaus, wo der Kapitän zur See mit einem lächelnden: „Danke, A.O.!“ den Kaffe wahrnimmt. Den schwarzen Gefechtsanzug hat der Kommandant an, dieses ungeheuer praktische und warme Stück, in dem jeder wie ein leibhaftiger Eskimo aussieht. „Was kann wohl in Scapa liegen, Herr Kapitän?“ fragt einer von uns, es ist eine Frage, die uns alle natürlich beschäftigt, man möchte gerne wissen, mit welchen Schiffen des Gegners hier oben eigentlich zu rechnen ist. Der Kommandant stellt die Tasse auf den Holzsitz, zieht nachdenklich an seiner Zigarre und zuckt die Achseln: „Dja, es kann allerhand in Scapa liegen, vielleicht Schlachtschiffe, der eine oder andere Flugzeugträger, von den neuen natürlich, Kreuzer und Zerstörer.“
Der Funkoffizier, der mit einer Meldung auf die Brücke kam und seine Tasse mit Pilzsuppe in der Hand hält, die vom Läufer als Mittelwächterfrühstück für das gesamte Brückenpersonal jetzt, kurz vor der mitternächtlichen Ablösung geholt wurde, nickt. Um Mitternacht etwa ist eine Kursänderung befohlen, dann drehen wir auf die Dänemarkstraße zu, die 140 Seemeilen breite Straße zwischen Island und Grönland, und werden ja sehen, ob die Engländer Überwasserstreitkräfte oben haben, wenn wir gemeldet sein sollten. Wieviele sie haben und welche – nun, das werden wir dann ja wohl erfahren! Von unten schrillen Pfiffe, die Backbordkriegswache wird gepurrt. Der B.Ü.-Offizier, übernächtig aussehend in der fahlen Beleuchtung, die Falten im Gesicht noch schärfer als sonst, lacht: „Manchmal hat man doch seinen Spaß: irgend jemand hat unten an einem Platz, den alle passieren müssen, die von den Mannschaftsräumen im Vorschiff heraufkommen, ein schickes Mädchenbild aufgehängt. Irgendeine Filmschauspielerin oder so. Und weiß der Teufel: jeder Matrose, der vorbeikommt, sieht das Bild an und – streicht sich die Haare glatt!“ Der Nebel ist nun so dicht geworden, daß „Bismarck“ einen ihrer achteren Scheinwerfer anstellt. Ein kreisrunder hellgelber Fleck steht nun wie eine kraftlose, sonnenförmige Scheibe über dem nur mit Mühe noch erkennbaren Schatten, der vor uns durch diese totenstille Nebelwelt geistert. Am Mittag, der dieser Nacht folgt, scheint die Sonne über einer dunkelblauen See – so wechselnd ist das
Wetter dieser hohen Breiten! Nichts ereignet sich, leer gefegt scheint die See, keine Rauchwolke, kein Flugzeug taucht auf, sie suchen wohl weiter südlich, die Engländer, und es scheint, als sollten wir gänzlich unbemerkt die Durchfahrt durch die Dänemarkstraße ausführen. Während des Mittagessens tönt, zunächst freudig begrüßt, eine OKW-Meldung aus dem Lautsprecher: „Unterseeboote versenkten aus einem für England bestimmten Geleitzug neun feindliche Handelsschiffe mit zusammen 70900 BRT.“ Darunter befanden sich drei Tanker von 8000, 10000 und 13000 BRT sowie ein schwerbeladener Munitionsdampfer von 7000 BRT. Weitere 18000 BRT wurden durch Unterseeboote in Einzeloperationen versenkt. Im Seegebiet westlich Afrika versenkten die Unterseebootswaffe in den letzten Tagen insgesamt 110300 BRT feindlichen Handelsschiffsraumes. Das von Korvettenkapitän [Günther] Prien geführte Unterseeboot ist von seiner letzten Fahrt gegen den Feind nicht zurückgekehrt. Mit dem Verlust dieses Bootes muß gerechnet werden.“ Wir sehen uns an – daß Prien, der beste Unterseebootskommandant, schon längere Zeit vermißt wird, ist uns allen bekannt. Aber wir haben immer noch gehofft, daß er irgendwo und irgendwie mit seinen tapferen Männern schon wieder auftauchen würde. Einem Prien, einem Mann, dem diese unglaubliche Tat von Scapa Flow gelang, war alles zuzutrauen. Nun im OKW-Bericht das Ende des allgemein beliebten und geachteten Offiziers bestätigt zu hören – das trifft doch jeden wie ein
harter Schlag. Mit ernsten Gesichtern hören wir, was der Bericht weiter von unserem Kameraden zu sagen hat: „Korvettenkapitän Günther Prien, der Held von Scapa Flow, der vom Führer in Anerkennung seiner überragenden Verdienste mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet worden war, und seine tapfere Besatzung leben im Herzen aller Deutschen weiter.“ Es ist nur zu natürlich, daß uns nach dieser Unglücksbotschaft die weiteren Meldungen des OKW heute nicht mehr interessieren, daß wir abstellen lassen und des Kameraden gedenken, der nun irgendwo in der Tiefe der von ihm so sehr geliebten See mit seinen Männern ruht, den Männern, die er so oft und mit so überwältigendem Erfolg gegen den Feind führte. Ein Abend in meiner Wohnung steigt vor meinen Augen auf: ein Freund, Kriegsberichter und Dichter, der selbst bei Prien eine Fahrt mitmachte, saß bei mir und erzählte. Es war die Fahrt, die für Prien zunächst keine Beute brachte und dann, als der große Geleitzug auftauchte, zu einer seiner er folgreichsten überhaupt wurde. Aber es ist nicht die Schilderung des Kampfes, was mir haftenblieb, als vielmehr das Bild, das der Sonderführer vom Menschen Prien entwarf. „Wir haben uns oft über Probleme unterhalten,“ berichtete der Leutnant, „die gerade jetzt so überaus wichtig sind, über Jugenderziehung und Soldatentum, Prien, der selbst außerordentliche erzieherische Fähigkeiten besaß, der erzieherisch stets an seinen Offizieren und seinen Männern arbeitete, weil er auch an sich selbst
die höchsten Anforderungen stellte und nie müde wurde, sich weiterzubilden, wäre ein Mann, der später einmal in der Jugenderziehung verwandt werden müßte. Alles, was mit dieser Aufgabe zusammenhängt, liegt ihm von Natur und es gibt wohl kaum ein Problem, über das er, neben seinem Dienst, so nachdenkt wie über dies, das für den Bestand unserer Nation wichtigste. Man muß es an Bord erlebt haben, wie dieser Offizier stets Zeit fand, auch außerdienstlich auf seine Offiziere und Männer einzuwirken, wie geschickt er das machte, und wie wertvoll das alles ist.“ Es sind die Grundsätze der Erziehung zum Soldaten, die gerade dieser Offizier in so vorbildlicher Weise beherrschte. Die Erziehung der Truppe hat die von einem Geist beseelte Gemeinschaft zum Ziel, das Ziel der Erziehung des einzelmen ist – wie Korvettenkapitän Sorge in seinem Buch: „Der Marineoffizier als Führer und Erzieher“ einmal sagt – der deutsche Soldat. Härte gegen sich selbst und Pflichttreue muß der Soldat lernen, Pflichterfüllung bis ins kleinste. Willenskraft muß das schwächliche „Ich kann nicht“ überwinden. Wer dies lehren will, muß selbst den Dienst des Soldaten während seiner eigenen Lehrjahre in allen Kleinigkeiten und Einzelheiten zu beherrschen gelernt haben. Hohe Anforderungen, die an die Truppe vor allem im Kriege gestellt werden müssen, gefährden die Stimmung und Disziplin in der Truppe am allerwenigsten, vorausgesetzt, daß der Offizier selbst sich nicht schont
und es versteht, seine Männer auch innerlich an der gestellten Aufgabe zu beteiligen. Bekanntgabe des Zieles eines Kriegsmarsches – soweit dies mit militärischen Gesichtspunkten, wie Geheimhaltung usw. vereinbar ist -, Unterrichtung über den Verlauf eines Gefechts durch die Telephon- oder Lautsprecheranlage, sowie es die Gefechtshandlung zuläßt, geben dem Soldaten das Gefühl, daß er nicht als willenloses Werkzeug, sondern als Mitglied einer Gemeinschat kämpft, in der Offizier und Mann Seite an Seite ihren Beitrag zum Erfolg leisten. Bedingungsloser Gehorsam, Unterordung unter den Befehl ist Grundlage aller soldatischen Leistung. Dabei wird gerade beim deutschen Soldaten Selbständigkeit des Denkens und Handelns bewußt gefördert, weil der Vorgesetzte mit Recht von ihm Festigkeit im eigenen Urteil erwartet. Ein Abweichen vom gegebenen Befehl kommt nur dann für den Soldaten in Frage, wenn er die Überzeugung gewinnt, daß eine veränderte Lage nun auch den Offizier veranlassen würde, den Befehl zu ändern. Dem deutschen Soldaten, dem besten der Welt, ist zuzutrauen, daß er bei gegebener Lage vom Wortlaut eines Befehls abweicht, um den Sinn des Befehls zu erfüllen. Zahlreiche Taten einzelner ungenannter Soldaten haben bewiesen und beweisen täglich aufs neue, daß der deutsche Soldat, von dem der Gegner behauptet, er sei nur willenloses Werkzeug einer gewaltigen Kriegsmaschine, bei Ausfall seiner Offiziere selbständig handelnd, die gefährlichsten Lagen als Führer seiner Kameraden zu meistern versteht.
Die Erziehung zur Härte gegen sich selbst ist gleichzeitig die Erziehung zur Furchtlosigkeit. Wer seine Nerven besser in der Gewalt behält, bleibt der Überlegene. Das beweist dieser Krieg. Die Herstellung eines gesunden Vertrauensverhältnisses zwischen Führer und Geführten, einer der Führungsgrundsätze für den Offizier, ist Grundbedingung für die Zuverlässigkeit und das Selbstvertrauen der Truppe. Korvettenkapitän Prien besaß das Vertrauen seiner Männer in besonders hohem Maße, weil er neben allen anderen Führereigenschaften die Gabe besaß, vom ersten Tage an dies Vertrauensverhältnis herzustellen. Er kannte seine Männer, faßte jeden, Offizier oder Mann, persönlich an, kannte die Leistungen jedes einzelnen, gute und schlechte, so daß jeder die Überzeugung gewann, es lohne sich, bei diesem Offizier das Höchste zu leisten, da ja die Leistung auch bemerkt und anerkannt wurde. An Bord des U-Bootes wußte jeder tüchtige Mann – und sie waren alle tüchtig, die unter Prien fuhren -, daß der Kommandant von ihm besondere Leistungen erwartete. Selbstachtung und Stolz auf die ehrliche Leistung knüpften hier wie allerorts in der deutschen Wehrmacht, das feste Band zwischen Offizier und Mann. Das Wort Günther Priens, das ich diesem Buch voranstellte, ist es, das im Gedenken an diesen echten deutschen Seemann, Soldaten und Nationalsozialisten doppelt an Wert gewinnt: „Was aber ist Erfolg? Man mag ihn Glück nennen oder Gnade. Das aber, worauf es ankommt unter Männern,
ist allein, das Herz eines Kämpfers zu haben und sich selbst vergessen zu können um der Sache willen, der man dient.“ Es waren die Nachrichten, die um 17 Uhr in Berlin gegeben werden, die uns das Geschick Priens verkündeten. Vier Stunden sind wir der deutschen Zeit in der Heimat vorauf, so weit westlich liegt nun unser Schiffsort. – In der Nacht von 22. auf den 23. Mai hat unsere Wache die Morgenwache. Wir stehen im nördlichen Eismeer, das den Kreuzer nach dem einen sonnigen Tag mit dichtestem Nebel empfängt, der naß, kalt, klebrig und feucht von überall her wie feiner Regen auf uns niedertropft. Grünlichgrau und kalkig weiß ist das Kielwasser, „Bismarck“ stellt in Abständen einen Scheinwerfer an. Wenn die fahlgelbe Scheibe vorübergehend verlischt, ist vom Flaggschiff absolut nichts mehr zu erkennen. Wie aus einem tiefen Keller weht uns die Luft an, und als plötzlich die ersten vereinzelten Eisschollen vorbeitreiben, wundert sich keiner mehr. Noch sind es nur wenige, die wie weiche dichte Haufen von Schnee bei der hohen Fahrt schnell achteraus sacken. „Wie Eierschnee auf der cremegelben Weinsuppe, die wir früher zu Haus manchmal kriegten,“ erinnere ich mich, „bloß die Sultaninen fehlen!“ „Und Ihre Suppe war bestimmt heiß, dies ist aber eiskalt hier!“ meint der A.O. „Ich werde mal ’nen Augenblick meine Rückseite aufwärmen im Stand. Ich sehe gar nicht ein, warum dauernd nur der Steuermannsmaat drinnen einen warmen Achtersteven haben soll!“
Der Heizkörper im Leitstand ist ein sehr begehrtes Objekt geworden, seit wir aus Norwegen ausliefen! Für kurze Zeit geht die Kampfgruppe auf Befehl von „Bismarck“ mit der Fahrt herunter, als die Eisschollen sich mehren, dann wird wieder auf die alten Umdrehungen gesteigert. Abwechselnd stellen wir uns an den Heizkörper. Im Stand ist es direkt mollig warm gegen die Kälte draußen, die Nässe und den Fahrtwind, der schneidend unsere Gesichtshaut erstarren läßt. Der Rollenoffizier befiehlt Ruderschüler auszubilden, aufmerksam beobachtet er von draußen das Ergebnis: „Auf dem Flaggschiff steuern auch Ruderschüler, sehen Sie bloß das Kielwasser an! Das reine Bandornament!“ Er beugt sich zum Sprachrohr, das hinter seinem Rücken den Panzer durchbricht und beim Rudergänger drinnen im Stand endet: „Nicht so viel Ruder legen! Geben Sie mal ein bißchen Anleitung, der Steuermannsmaat! Wir fahren doch keine U-Bootssicherung hier! Ganz wenig Ruder, Mann!“ Der Kapitänleutnant nimmt eine Zigarette aus der silbernen Dose: „Es ist natürlich schwer, vernünftig zu steuern, wenn der Vordermann wie ein fliegender Bettsack durch die Gegend schlängelt. Aha, nun geht’s schon besser! Warum nicht gleich, Jungchen!“ Der Torpedooffizier, blaß und frierend, sucht mit dem Glas vergebens das Flaggschiff auszumchen, von dessen Vorhandensein nur noch das milchig grüngraue Kielwasser zeugt. Der Kapitänleutnant, der gerne ein
bißchen meckert und bei jedem Disput ziemlich temperamentvoll zu werden und leicht zu unken pflegt, läßt das schwere Glas fallen: „Wenn das nun morgen, wenn es wieder aufklart, plötzlich die ‚Nelson’ wäre?“ Wir sehen den T.O. sprachlos an. „Na ja, ich meine, wir sehen doch jetzt überhaupt nichts und man kann sich doch vorstellen, daß irgend so ein Engländer auf einmal auftaucht.“ Der Artillerieoffizier, geborener Optimist, der er ist, lacht schallend: „Mann, was Sie sich auch immer ausdenken! Und wenn so ein englischer Vogel erscheint: schnell ohne Verfahren Granaten in die Fresse schmeißen! Klar? Übrigens haben die lieben Vettern über diesem netten Fjord, in dem wir uns neulich sonnten, gestern nacht Leuchtbomben abgeworfen. Anscheinend suchen sie uns aber tatsächlich südlicher, in der Nordsee.“ Mühsam krempelt der Korvettenkapitän Lederjacke, Pullover und Weste um, angelt nach seiner Uhr und klappt den Deckel auf: „Wieviel Uhr ist es eigentlich, Kinder? Seit wir dauernd die Klock zurückstellen, weiß ich nie Bescheid! Aha, noch 45 Minuten bis Buffalo! Läufer, Läufer! Der lehnt sicher, wie vorhin seine hohen Herrn, an der Heizung im Stand! Läuferrrrr! Zum Teufel noch eins!“ Ein wenig schuldbewußt erscheint der Gerufene und macht eine besonders schöne Ehrenbezeugung. „Mein Gott, wo steckt ihr denn eigentlich? Also: vier Brotschnitten holen, meine Butterration aus der Offizierspantry und Kaffee, savvy?“
„Jawohl, Herr Kapitän.“ „Ich habe,“ erklärt und der A.O., „keine Lust, mit dem Frühstück in der Messe meine kostbare Schlafenszeit zu verplempern. Nun sehen Sie nur diese Eisschollen! Na, Graf, wie ist’s jetzt mit Ihrem Eismeer, sind Sie zufrieden?“ Der E-Meßoffizier [Oberleutnant zur See Graf von Matuschka], der zufällig auf der Brücke ist, hebt die Hand zur Mütze und lächelt: „Jawohl, Herr Kapitän, vollkommen!“ Immer dichter wird der Nebel, immer häufiger treiben Scharen von Eisschollen vorüber, große und kleine, und alle mit jenem eigenartigen grünlichen Schimmer. Der Läufer kommt mit Teller und Besteck, Brot, Butter und Kaffeekanne: „Herr Kapitän möchten den Teller und das Besteck -“ Mit der Hand winkt der Korvettenkapitän ungeduldig ab: „Ja, ja, ich weiß schon: die Pantry will den Kram wiederhaben. Soll sie auch. So, meine Herren, heute findet das Frühstück auf der Terrasse statt. Bißchen kalt zwar, aber immerhin!“ – Mittags um 13 Uhr wird die Uhr wieder um eine Stunden auf Ortszeit zurückgestellt. Langsam verschwindet der Nebel, gegen 14 Uhr ist es schon erheblich sichtiger, die Eisschollen sind verschwunden, die Kimm ist klar über einer dunkelgrüngrauen See, die kleine weiße Schaumköpfe aufgesetzt hat. Wir halten etwas mehr westlich zur Packeisgrenze hinüber, die vorläufig noch unsichtbar bleibt, aber nicht allzu fern sein kann.
Ich sitze in meiner Kammer und mache ein paar Notizen, als fünf schrille Töne mich aus der Arbeit aufjagen und an Deck stürzen lassen. Alarm? Nein, es war nur das Telephon am Drillingssatz der Torpedowaffe vor der Kammer, das vom Posten nicht gleich abgenommen, fünfmal losgellte. Nachmittags besuche ich, gut ausgeschlafen, den Maler [Leutnant (S) Julius C. Schmitz-Westerholt]. Als ich nach dem Anklopfen seine Kammer betrete, saust er von der Koje und zeigt bereitwillig die ausgezeichneten bunten Skizzen und Zeichnungen, die er seit seiner Anbordkommandierung und früher machte. Wunderbare Sachen sind darunter: Bombenangriff auf die Comercial Docks in London, Zeichnungen von Narvik, den Zerstören und der Landschaft, Kaliberschießübungen der „Prinz Eugen“ in der Ostsee, der Schwere Kreuzer im Dock, dann wieder leicht hingehauchte farbige Szenen von der Fahrt, jener wunderbare Sonnenuntergang vor der norwegischen Küste, der stille Fjord und halbfertige Skizzen von der „Bismarck“. „Können Sie nicht mal ein paar dieser Zeichnungen nehmen und dazu einen Artikel schreiben? Das könnte ich wundervoll für meine ‚Kriegsmarine’ brauchen!“1) Wir sprechen darüber und ich entschuldige mich, daß ich ihn ausgerechnet aus dem Schlaf gereppt habe. „Das macht nichts, Herr Kapitän,“ meint er und schüttelt den Kopf, „nachts kann man doch nicht so berühmt gut schlafen, man wacht von jedem Fahrtwechsel und jeder Kursänderung auf, weil man immer denkt, nun geht es los. Bei mir ist das jedenfalls so, darum suche 1)„Die Kriegsmarine“, Deutsche Marine Zeitung, K.K. Fritz Otto Busch, Hauptschriftleiter. UR.
ich das am Tage möglichst nachzuholen. Und mit den Bildern und einem Artikel, das werde ich überlegen. Für die ‚Kriegsmarine’ arbeite ich sehr gern mal wieder.“ Wir verlassen die Kammer und gehen noch ein wenig auf der leeren Schanz auf und ab, auf der nun die Strecktaue gespannt sind. Bei den Leichten Flawaffen, die steuerbord und backbord neben dem achteren Leitstand über den ins Weite drohenden 20,3-cm-Rohren der Schweren Türme ihre schwarzen glänzenden Läufe gen Himmel recken, und beim achteren Entfernungsmeßgerät sieht man die Köpfe der Bedienungsmannschaften, Ausgucks sichern und suchen mit ihren Doppelgläsern die jetzt einigermaßen klare Kimm ab. Vor der Tür des Niedergangs zum Zwischendeck halten drei Stabsfeldwebel ihren Kriegsrat. Ein Aufklarer geht nach achtern, den Inhalt eines Papierkorbs außenbords zu schütten, und zwei Zimmermannsgäste versehen die schwer gängigen Vorreiber der Schottür mit Öl und Fett. Nichts deutet auf irgend etwas Besonderes hin, niemand ahnt, daß nur zwei Stunden später die ersten Salven der „Bismarck“ über die See dröhnen werden. Im Gegenteil: wir nehmen nach der Ruhe der letzten beiden Tage eigentlich an, daß wir unbemerkt blieben und den Marsch durch die Dänemarkstraße ohne feindliche Einwirkung ungestört vollziehen können. Vor dem Abendessen überrascht mich der Alarm in der Kammer, gerade als ich dabei bin, das weiße Jackett anzuziehen. Es fliegt kurzerhand auf das grünbezogene Sofa, ich reiße das blaue Jackett, Schwimmweste, Doppelglas und Photosachen vom Haken und rase hoch.
Die Bedienung des steuerbord achtersten Schweren Flageschützes, die ich im Vorbeilaufen frage, weiß auch nicht, was los ist, also rauf zur Brücke. Oben gibt der Stabsobersteuermann Auskunft: „Der Alarm kam von ‚Bismarck’, Herr Kapitän. An Steuerbord scheinen Rauchwolken in Sicht zu sein.“ Schnell sehe ich mich um: dunkelgrau zieht die See, leichter Seegang wirft kleine Schaumköpfe auf, Eisschollen treiben vorbei. Nach Backbordseite zu ist der Himmel diesig und schmierig, an Steuerbord ist es heller. An einem der Steuerbord-Brückengläser steht schweigend der Kommandant. Ich stelle mich hinter das unbesetzte zweite und suche angestrengt zu ergründen, was da wohl in Sicht sein kann. Fast gleichzeitig lassen wir die Gläser los und drehen uns um: „Eis!“ sagt der Kommandant. „Das ist doch Eis!“ stelle ich ebenfalls fest. Dann steige ich in den Vormars, denn ganz genau ist eigentlich von hier unten nicht auszumachen, ob drüben Eisberge oder Eisfelder sind, auch scheinen die schwarzen, senkrecht aufsteigenden Striche vor dem undefinierbaren eisfarbenen Hintergrund tatsächlich von Dampfern zu stammen. Wie Rauchfahnen sehen sie aus, Rauchfahnen, die über ziemlich langen dünnen Schornsteinen stehen. Vom Vormars muß man das genau ausmachen können. Hier hat sich auch der Artillerieoffizier, der bei dem Alarm sofort hochenterte, hinter einen seiner Zielgeber geklemmt und beobachtet. Ich nehme das scherzhaft so genannte „Gästeglas“, stelle die Optik ein und erkenne, daß drüben, die düstere
dunkelgraue Wasserfläche begrenzend, ein unendliches Eisfeld liegt. Keine Eismauer, wie es von unten fast schien. Je höher man stieg, desto niedriger wurde diese scheinbare Eiswand, bis eben dies endlose Eisfeld übrigblieb, auf dem schwarze Striche – wohl lange Risse im Packeis – waren, die von unten, von der Brücke aus wie die steil aufsteigenden Rauchfahnen von Dampfern aussahen. Der A.O. und ich sehen noch eine Weile hinüber, um ganz sicher zu sein, dann entern wir nieder. Auf der Brücke ist inzwischen auch alles erkannt und durch Meldungen aus dem Vormars, von den E-Meßgeräten und Ausguckposten die wahre Natur der angeblichen Rauchfahnen einwandfrei festgestellt worden. Die Kriegsfreiwache kann wegtreten, lachend verschwinden die Männer, einige bleiben auf dem Mitteldeck stehen und staunen dieses Eisfeld an, das von hier unten immer noch wie eine lange, endlose und steile Eisbarriere aussieht. Die Offiziere der Freiwache eilen in ihre Kammern, sich zum Abendessen klar zu machen, zu dem der Gong in wenigen Minuten rufen wird. Die Packeisgrenze, von der man so viel gehört hat, haben wir also erreicht! Hinter ihr liegt Grönland – nie hätte man gedacht, das jemals zu sehen! Eigentlich toll, daß wir bisher vom Feinde ungeschoren blieben. Trotz der hellen Nächte und des vorübergehend aufklarenden Wetters. Hoffentlich wird es wieder dick, gerade hier können wir Nebel besonders gut brauchen, Nebel, Schnee oder Regen – alles, was die Sichtigkeit verringert oder gar ausschaltet wie vorgestern. Ein wenig Glück noch, dann haben wir den Durchbruch geschafft! –
|

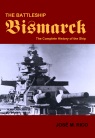 BOOK: The Battleship Bismarck. The Complete History of the Ship.
 Naval & military gifts
|