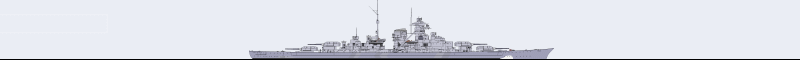„Prinz Eugen, der edle Ritter, „Wie die Festung Helgoland!“ meinte einer der Leutnants, „wenn die in See ginge, sähe es nicht anders aus!“ Immer wieder sahen wir hinüber, bewunderten die Schweren Türme, die Brückenaufbauten, die mit dem breiten wuchtigen Schornstein zusammen eine fast über der Schiffsmitte aufragende Pyramide bilden, den wunderbaren eleganten Sprung des endlosen Vorschiffs, die lange Schanz und die Rohre der Flageschütze und Flawaffen, die überall wie blitzende schlanke Speere eines zum Igel geschlossenen Landsknechtshaufens aus dem Gewirr vor Stahl und Eisen hervorstanden. Langsam glitt der Kreuzer zwischen den langen Molen auf Reede, donnernd polterte der Steuerbordanker in die Tiefe. Wir liegen und warten. Vorn auf der Back, wo die Kuttergäste der Wache eben vom Ankermanöver zurückkommen, schreiten ein
paar Offiziere auf und ab, hier und da wirft einer einen schnellen Blick hinüber, dorthin, wo mit langsamer Fahrt die „Tirpitz“ zu irgendeiner Übung umherkreuzt oder die „Lützow“, grell von der Nachmittagssonne beleuchtet, ebenso wie wir zu Anker liegt. „Jetzt müssen wir doch wohl bald auslaufen,“ unterbricht der Leitende Ingenieur [Korvettekapitän (Ing.) Graser] das gleichmäßige Tappen der Schritte auf dem blank gewaschenen Holzdeck. „Glaub’ ich nicht,“ wirft der Schiffsarzt ein, „die ‚Bismarck’ macht doch noch gar keine Anstalten zum Auslaufen, haben Sie das nicht gesehen?“ „Verdammte Warterei!“ flucht der Artillerieoffizier und hält die Hand schützend vor die Augen. „Meinen Geburtstag haben wir gefeiert, nun kann’s doch wahrhaftig losgehn!“ Der Geburtstag des A.O. war eine Sache für sich und fing bereits morgens sehr lusting an. Ich hatte die Geschichte nicht so genau erfahren, über die alle so lachen mußten morgens in der Messe, und frage den Korvettenkapitän, wie es denn eigentlich gewesen wäre mit dem Geburtstagsständchen. „Dja, ziemlich peinlich für mich!“ Ich saß gerade in der Badewanne. In der Nähe meiner Kammer ist ja ein Baderaum, und da höre ich auf einmal mächtiges Geblase und Geschmetter,“ erzählt der A.O. „Natürlich fiel mir mein Geburtstag ein und daß nun wohl die braven Männer von meinem Palast eine Sondervorführung starteten. Mir blieb also nichts übrig, als mich aus der Wanne zu schwingen, meinen Bademantel so à la Toga um die Schulter zu werfen und hinzueilen. Sie merkten
erst gar nicht, daß ich hinter ihnen stand, bis ich den nächsten antippte: ‚ich bitte durchtreten zu dürfen!’ Na, die Gesichter hätten Sie sehen sollen! Meine Kammer war nämlich abgeschlossen gewesen, und sie dachten, ich schliefe noch. Es war sehr schön, und ich habe dann mit der Kapelle einen ordentlichen Sonnenaufgangsschnaps verlötet. Das hatten sie wohl verdient.“ Eine wunderschöne Karavelle mit allem Takelwerk und unter Segel hatten die Artilleriemechaniker ihrem A.O. in monatelanger Arbeit nach genauen Modellplänen hergestellt und überreicht, ein Gedicht von einem Modell, das nun festgelascht in der Großen Kammer unter der Brücke thronte, und wir hatten bei ihm gesessen und den Grammophonplatten zugehört, die er unermüdlich ablaufen ließ, von „Luise, Luise“, dem Marinelied der Nachkriegszeit und dem Matrosensong „In Hamburg an der Elbe, dicht hinter dem Ozean“, bis zu dem entzückenden Lied der Rosita: „Es saßen einmal, es saßen einmal vier Mädchen auf der Bank!“ Ich erinnere den A.O. an den netten Nachmittag gestern und unsere Gespräche über die bevorstehende Unternehmung, begeistert schlägt er mit der Hand durch die Luft: „Menschenskind, wenn wir wirklich zum Feuern kommen, kriegen Sie die Platte von den vier Mädchen auf der Bank vorgespielt, sooft Sie wollen!“ Richtig, das hatte er ja versprochen! Das Gefecht haben wir gehabt, weiß der Teufel – genau sieben Tage später. Aber wir hatten wahrhaftig keine Zeit, die Platte zu spielen, lieber Gott und alle kleinen Fische!“
Und nun liegen wir auf Reede und warten. Und es sieht nicht so aus, als ob unser Flaggschiff heute noch aus dem Hafen liefe. Keineswegs. Zartblau ist die See, verschwommen die dunstige Kimm, weit in der Ferne zieht die Rauchfahne eines unsichtbaren Dampfers von Nord nach Süd. Über dem Hafen im Westen liegt die Luft wie eine goldene, schimmernde Wolke. Als die Nacht hereinbricht, ist zwar immer noch kein Seeklar-, kein Auslaufbefehl vom Flaggschiff gekommen, aber die Ungeduld, die Spannung und Erwartung steht jedem Mann der Besatzung im Gesicht geschrieben. – Endlich! Seit voriger Nacht fahren wir! Laufen hinter dem Schlachtschiff auf einer grün-blauen See, haben Hafen und Reede bereits weit hinter uns und sehen an Backbord Berge aus dem Wasser steigen, bewaldete Berge und beobachten weiße Segel von Fischerbooten, die wie Papierschnitzel in der Ferne verstreut aufleuchten. Breit und schnurgerade schäumt das Kielwasser der beiden Kriegsschiffe. Auf dem Kreuzer ist Waffendienst: Rohre schwenken und heben sich, Feuerglocken schrillen, gelbe Messingkartuschen poltern in die geöffneten Rohre, Verschlüsse klacken dicht, überall ist Leben, Bewegung und eine zum höchsten gesteigerte Spannung. Recht voraus ragt ein Leuchtturm über hohem Küstensaum, plötzlich haben sich auch tarnbemalte Sperrbrecher zwischen uns geschoben, plötzlich laufen zwei graue große Zerstörer in unserem Kielwasser,
röhren Flugzeuge in der Luft und schwirren über der Kampfgruppe, kurven, sausen in betäubender Fahrt voraus, huschen wie glitzernde Insekten mit schillernden Flügeln im Blau, kehren zurück, das Spiel von neuem zu wiederholen, ein Spiel, das unserer Sicherheit dient. Bedeckt wird der Himmel, grau breitet sich die weite See, bleifarben und stumpf, nur das Kielwasser zieht seine weiße Schleppe durch das farblose Einerlei. Auf der Kreuzerbrücke beugt sich ein Kapitänleutnant zum Ohr des Artillerieoffiziers, der neben dem Wachhabenden die Seeaufklärer beobachtet, die neben und vor der Kampfgruppe fliegen: „11 Uhr 15 Allemann achteraus – nun ist es ja wohl so weit!“ Wie ein Lauffeuer geht es durchs ganze Schiff: 11 Uhr 15 wird der Kommandant sprechen, wird Sinn und Ziel der Unternehmung bekanntgeben, zu der dieser Verband auslief. Gottseidank, die Wartezeit ist beendet, nun geht’s endlich raus: ran an den Feind, raus in die Weite des Atlantik, ran an die Geleitzüge, an den Engländer! Es ist, als ob ein elektrischer Funke gezündet hätte, als ob urplötzlich ein starker Strom durch alle Decks ginge, ein Kampfsignal die Männer aufgescheucht hätte, die seit Wochen, seit Monaten schon nichts sehnsüchtiger erwarteten, als mittun zu können, wenn draußen auf den grauen Wogen mit stählernen Würfeln um das Geschick des Reiches gewürfelt wird. Achtern auf der Schanz stellen Matrosen das Mikrophon für den Kommandanten auf, schließen Kabel an die Lautsprecheranlage und prüfen das Gerät. Schmunzelnd
sieht der Erste Offizier zu und lächelt seinen Läufer an: „Merkst du was?“ Der strafft sich und lacht: „Jawohl, Herr Kapitän! Jetzt geht’s los!“ Als der Pfiff „Allemann achteraus!“ durch die Lautsprecheranlage gellt, füllt sich die Schanz. Die Divisionen treten an, quer vor dem Mikrophon baut sich die Bordkapelle auf, an Steuerbord und Backbord formieren sich die Männer, werden gemeldet und unter den achteren Schweren Türmen, deren lange Rohre in die Weite drohen, steht das Offizierkorps des Kreuzers. Der Erste Offizier läßt schnell an Bord vervielfältigte Blätter verteilen. Erstaunt greifen die Männer danach, lesen den Text und lachen sich an: das Lied von Prinz Eugen! Das alte Kampflied der Ostmark, das jetzt bei den Sondermeldungen des Balkanfeldzuges fast täglich aus dem Radio aufklingt, das Lied des Schweren Kreuzers – unser Lied! Der Erste Offizier betritt das kleine Podium, die Palaverkiste des Kommandanten: „Stillgestanden! Steuerbordseite Augen rechts! Backbordseite die Augen links! Ich melde dem Kommandanten!“ In der Stille hört man die Schritte des Fregattenkapitäns, der zur Meldung nach vorne geht, auf dem Holzdeck hallen. Leise rauscht die Hecksee, eine Schottür schlägt, über dem Heck schweben ein paar Möwen, und hinten, über den Köpfen der im blauen Zeug angetretenen Matrosen stehen die Masten der im Kielwasser
folgenden zwei Zerstörer nadelfein gegen den grauen Himmel. Plötzlich tönt hell, schmetternd, aufreizend ein Signal aus dem Lautsprecher, dreimal wiederholt: das Signal des Balkanfeldzuges, dem das Prinz Eugen-Lied folgt. Alles hört erregt, erwartungsvoll zu: ist eine neue Sondermeldung da? Soll dies die Einleitung zur Kommandantenansprache sein? Da erscheint auch schon der Kommandant, grüßt, läßt rühren und betritt die Palaverkiste. Einen Augenblick lang gleitet sein Blick über die langen Reihen seiner Männer, dann hebt er kurz den Kopf und beginnt zu sprechen. Es ist eine knappe und soldatische Ansprache, die der Kapitän zur See hält. Er weist auf das Symbolische hin, das darin liegt, daß zwei Schiffe, die den Namen eines Kanzlers und eines Feldherrn tragen, hinausgehn, den Feind zu schädigen, der den Begriff der Freiheit der Meere zum Gespött macht. Aufmerksam hört alles zu, und es liegt wie ein stummes Gelöbnis auf allen Gesichtern, als der Kommandant kurz bekanntgibt, daß unsere Kampfgruppe auf Befehl des Führers und Obersten Befehlshabers hinausgeht. Laut und freudig hallt das Siegheil auf den Führer über die See, und als nun die Bordkapelle das Prinz Eugen-Lied und die Lieder der Nation spielt, singen alle begeistert mit. Wie eine Erlösung geht es durch die Reihen, eine Erlösung nach endlos scheinender Wartezeit, und als nach dem Wegtreten die Offiziere dem Kommandanten in die Kajüte folgen, hören sie noch lange das fröhliche Lachen und die Rufe der Männer heraufschallen. Im Kommandantensalon stehen wir um den Rundtisch und lauschen
den Worten des Kapitäns zur See, der die Aufgabe klarlegt, die uns nach Passieren der Enge Shetland-Bergen zunächst ins Nordmeer führen wird. Ein paar anschließende Worte über Wichtigkeit des Ausgucks, über verschiedene sofort zu treffende Maßnahmen folgen. Von der Wand sieht das große Bild des Feldherrn mit dem Marschallstab ernst und beschwörend herab, an der cremefarbenen Decke spiegeln sich Licht und Schattenflecke der draußen vorbeirauschenden See, und im stillen schwört wohl jeder von uns, seine Pflicht zu tun und mehr als die Pflicht, wenn das Schicksal uns ruft und es hart auf hart geht. Wir, die wir hier versammelt sind, kennen zum größten Teil den Engländer, wir wissen, jedenfalls die älteren unter uns, die wir den Weltkrieg auf den Schiffen der Hochseeflotte mitmachten, daß er kein zu verachtender Gegner, daß er zäh und hart und von allem fast stets in der Überzahl ist. Wir kennen seine Schiffe, aber wir denken nicht an die Zahl, wir vertrauen auf das bessere Material, die sorgfältigere Ausbildung, die kühnere Führung und den Geist, den Führer und Bewegung in unserem Volk und unserer jungen Wehrmacht zu wecken und zu erhalten verstanden. Und wir vertrauen diesem, unserem Kommandanten, der ruhig and klar seine Worte wählt und dem wir folgen werden, bedenkenlos und freudig, wohin er uns auch führen mag. Niemand spricht ein Wort, als wir die Kajüte verlassen, unsere Bordmützen von den Haken nehmen und am präsentierenden Posten vorbei den schmalen Niedergang
zum achteren Offizierswohndeck hinabgehen. Es ist, als ob das Signal, das schmetternde, Kampffrohe, helle Signal in uns allen nachhallte.- Vor uns läuft, nachdem die Sperrbrecher entlassen sind, die „Bismarck“. Breit ist ihr mächtiges Kielwasser, ein weißdurchwirkter, vielgemusterter Teppich auf der farblosen See. Auf der geräumigen Schanz arbeiten Matrosen, legen Leinen klar, malen das Fliegererkennungszeichen nach, die Nationalflagge, die auch bei uns auf Schanz und Back quer über die Schiffsbreite hinweg deutschen Fliegern Aufklärung geben soll. Wie schwer es ist, aus einem Flugzeug, noch dazu aus großer Höhe, Schiffstypen richtig zu erkennen und zu bestimmen, weiß nur der, der selbst einmal in einem Flugzeug saß und nicht sagen konnte, ob das Fahrzeug unten ein Zerstörer, Kreuzer oder Schlachtschiff war. Wir sprechen darüber auf der Brücke, während auch bei uns ein paar Matrosen die große Hakenkreuzflagge nachmalen, die unter den Ankerketten auf der Back dicht vor den Spills von Poller zu Poller reicht. „Es muß rasend schwer für die Flieger sein,“ meine ich, „ich habe selbst einmal während irgendeines Kaliberschießens der alten guten ‚Hessen’ in so einem Flugzeug gesessen, und obgleich man genau wußte, welche Schiffe in Frage kamen und draußen in der Bucht herumfuhren, wurde das Bestimmen doch sehr schwer. Ganz abgesehen davon, daß der Flugzeugführer sich natürlich einen besonderen Spaß daraus machte, uns ganz gehörig in der Luft herumzuschaukeln! Dazu ein offenes Flugzeug, wissen Sie!“
Der Artillerieoffizier, der mit dem Glas einen der Positionsdampfer beobachtet, der voraus im Fahrwasser zu Anker liegt, dreht sich um: „Das kann doch damals nicht so schwer gewesen sein, da konnten diese ollen Verkehrsmühlen, die bei uns zuweilen mithalfen, doch gar nicht so hoch steigen?“ „Na, mir hat es genügt, muß ich sagen. Ich glaube, es geht allen so, die zum ersten Male verantwortlich einen Schiffstyp vom Flugzeug aus ausmachen sollen. Typenkunde ist bestimmt bei der ganzen Kriegsfliegerei, soweit sie über See geht, enorm wichtig. Später, als ich öfter im Flugzeug saß, lernte man natürlich schon besser zu unterscheiden. Ich bin häufig rübergeflogen nach London, und da begegneten einem im Kanal, so zwischen Scheveningen und dem Mouse Feuerschiff in der Themsemündung zuweilen Kriegsschiffe. Einmal war es ein Verband unserer Leichten Kreuzer, der den von Madeira heimkommenden K.d.F.-Schiffen ein fabelhaftes Evolutionieren vormachte. Ich habe es aber auch erlebt, daß unten, schon innerhalb der breiten Mündung der Themse ein altmodischer Raddampfer mit enormem Kielwasser seinen Weg zog und fast alle an Bord der Ju der Meinung waren, es sei ein Zerstörer, der – ein britischer natürlich! – mit rasender Fahrt dahinschoß!“ Der Torpedooffizier, der zugehört hat, nickt bestätigend: „Typenkunde ist verdammt wichtig. Selbst für uns, die wir die Schiffe doch seitlich meist in voller Silhouette sehen, ist es schwer, z.B. die vielen englischen Kreuzertypen auseinander zu halten. Und wenn so ein Bursche
dann auch noch im spitzen Winkel auf einen zuliegt, oder Neben und Dunst die Umrisse verzerren, dann ist es fast unmöglich.“ „Stimmt: im Weltkrieg haben wir auf unserer Kreuzergruppe einmal glatt die eigenen Minensuchboote, die plötzlich unerwartet aus einer Nebelwand auftauchten, für feindliche Lienenschiffe gehalten. Sie lagen sehr spitz auf uns zu, die Vorschiffe schienen himmelhoch und bei der ruhigen See hatten die Boote einen beachtlichen Schnurrbart vorm Bug!“ Ein Pfiff unterbricht unsere Unterhaltung. Wir schweigen und suchen zu verstehen, was der Lautsprecher zu verkünden hat: „Jedes Mitglied der Besatzung trägt ab sofort Schwimmwesten!“ „Gottseidank, langsam nähern wir uns doch dem Kriegsgebiet!“ lacht der Rollenoffizier und beugt sich zum Sprachrohr, das von der Brücke zum gepanzerten Stand führt, um dem Rudergänger eine Anweisung zu geben. Obgleich hier wirklich außer Minen, englischen Unterseebooten oder Flugzeugen nichts kommen kann, gibt der ausgepfiffene Befehl doch immerhin das erhebende Gefühl, daß die Sicherheitszone wohl überschritten ist, daß man endlich der Frontline näher kommt, dem großen Geschehen, dem Feind, dem Kampf. Das Nietzschewort fällt mir ein, das gerade für den Soldaten so wahr ist, der nichts mehr haßt als unkriegerische Untätigkeit, Wartenmüssen und fern der Front sein. Wie sagte der große Philosoph mit dem Kämpferherzen? „Lebe gefährlich!“
Und das ist es, was neben vielem anderen den Soldatenberuf so reizvoll, das Leben unter Kameraden im Kriege für jeden echten Mann so unerhört spannend und reich macht. Nichts kettet fester zusammen als gemeinsam überstandene Gefahren, und nichts läßt die Herzen höher schlagen als Einsatz und Kampf, weil es die Bewährung bedeutet für all das, was Richtschnur und Leitstern unseres Lebens sein soll. Zwar ist es noch lange nicht so weit, aber dieser Pftiff, der an jenem trüben Vormittag durch das Schiff schrillte, war trotz Kommandantenansprache und Auslaufen doch eigentlich das erste Zeichen, daß es nun wirklich Ernst wurde. Wir haben dann die schilfgrünen Schwimmwestenbeutel am grünen Leinenriemen getragen, Tag und Nacht, auf Kriegsmarsch und im Gefecht, und wieder auf Kriegsmarsch. Sie waren unsere ständigen Begleiter, und wir haben oft geflucht, wenn wir mit den Beuteln beim Alarm irgendwo in den Niedergängen oder beim hastigen Aufentern zur Gefechtsstation in den Vormars zwischen den Steigeisen des obersten Aufgangs hängenblieben. Gebraucht haben wir sie nie, und die grellgelben Schwimmwesten blieben glücklicherweise stets unaufgeblasen in den Beuteln, höchstens, daß man noch einen Photoapparat und Filmpacks hinzustopfte. Von der Signalbrücke, die gleichzeitig Admiralsbrücke ist, ruft der Signalmaat der Wache einen Winkspruch herunter, der vom Flaggschiff gegeben wurde. Er kommt vom Chef des Stabes der Flotte, meinem Crewkameraden, Kapitän zur See [Harald] Netzband. Schnell kritzele ich die Antwort zwischen die Linien der Kladde.
Vor Jahren wohnte ich bei dem Stabschef, der damals in Kiel irgend wo kommandiert und leider auf Reisen war, als ich eine größere Sperrübung als Korrespondent mehrerer Zeitungen zu schildern hatte. Rührend wie von der Schreibmaschine und dem Schreibpapier bis zu den Bleistiften, Essen und gutem Wein alles für mich vorbereitet und klar stand. Tatsächlich ging dann auch die ganze Nacht damit hin, daß verschiedene Artikel geschrieben und per Telephon nach Berlin durchgegeben werden mußten. Schlachtschiffskommandant war er im jetzigen Kriege, war dabei, als die „Renown“ ihre Treffer bekam und später, als die „Glorious“ mit ihren beiden Geleitzerstörern „Ardent“ und „Acasta“ versenkt wurde. Alter Weltkriegstorpedobootsfahrer von der II. Flotille. Ich freue mich, daß er mit in der Kampfgruppe fährt und nun, Chef des Stabes, beim Flottenchef ist. Ich denke an seine Erzählung aus dem Weltkrieg, wie sie mit der II. Flotille in der Nordsee Dampfer knackten und im Kanal die große Lichtsperre aufräumten, die von Dover bis Calais unseren Unterseebooten so viel zu schaffen machte. In seiner Kieler Wohnung hingen neben einer sturmzerfetzten Zerstörerflagge viele Photos der großen langen Hochseeboote, die so wunderbar aussahen und oft bei uns, den damaligen Kleinen Kreuzern vorneweg als Aufklärung mitfuhren. Wie eng begrenzt war doch damals unser Tätigkeitsgebiet! Die Deutsche Bucht, für die Torpedoboote und Zerstörer allenfalls hier und da einmal der Kanal und, wenn es hoch kam, die nördliche Nordsee. Und jetzt? Überall im Atlantik laufen unsere schweren Überwasserstreitkräfte, Gefechte waren
bis hoch hinauf in die Gegend von Jan Mayen, bei Island, den Faröern und auf der Höhe von Narvik – und unsere Zerstörer? Nun, die Sturmfahrt nach Narvik, zweitausend Meilen vom heimatlichen Stützpunkt ist noch in aller Munde, im Bristol-Kanal haben sie englische Kreuzer un Zerstörer gestellt und patrouillieren von den Häfen der nordnorwegischen, der Kanal- und Atlantikküste aus im feindlichen Küstenvorfeld vom nördlichen Eismeer bis zur Südgrenze der Biskaya. Vor dem brandungumtosten Wall der Seefront hält die Kriegsmarine die Wacht auf dem Meere. – Auf der Schanz treten die Prisenkommandos des Kreuzers mit ihren Offizieren an. Das schwarze Koppel über dem kurzen Matrosenmantel, Maschinenpistole und Patronentaschen umgehängt, stehen sie da und hören dem Unterricht zu, den die Prisenoffiziere, erfahrene Fischdampferkapitäne und Handelsschiffsoffiziere, geben. Ich trete hinzu und frage einen der Leutnants, die sämtlinch die Uniform der Sonderführer tragen, was denn so eigentlich zu den Schiffspapieren gehört, die ein Prisenoffizier auf neutralen und feindlichem Dampfern – soweit sie nicht, im Geleitschutz unter feindlichem Waffenschutz fahrend, Waffenanwendung gegen sich herausfordern – zu untersuchen hat: „So ungefähr bin ich im Bilde, aber ich möchte doch genauer wissen, was für Papiere überhaupt so ein Dampfer führt, jedenfalls die hauptsächlichen.“ Der grauhaarige Leutnant, im Frieden Kapitän des Dampfers „Gerolstein“, schlägt den hochgestellten Kragen seines feldgrauen Wachmantels, den er auch
auf der Brücke stets zu tragen pflegt, herunter: „Es sind eine ganze Anzahl von Urkunden, Herr Kapitän. Für das Schiff und für jeden einzelnen Seemann an Bord. Sie sind alle in den Händen des Kapitäns, der sie meist in einer besonderen Kassette verwahrt. Für uns sind am wichtigsten das Konnossement und das Manifest. Das Konnossement ist eine rechtsgültige Quittung für das dem Schiff abgelieferte Gut, das darin genau bezeichnet wird. Zahlungs- und Beförderungsbedingungen, Frachtraten usw. sind angegeben. Das Manifest ist vom Verfrachter angefertigt und ist ein Verzeichnis der gesamten Schiffsladung, das als Ausweis dient. Bill of lading for goods und Manifest of Cargo heißen diese Papiere im Englischen. Die anderen gehen uns eigentlich als Prisenoffiziere wenige an, trotzdem sind sie natürlich ebanfalls zu prüfen: so der Paß des Schiffes, das sogenannte Schiffszertifikat, das Namen, Gattung, Ergebnis der Raumvermessung, Baujahr, Heimathafen, Reeder und Unterscheidungssignal des Schiffes enthält. Unterscheidungssignale kennen Herr Kapitän doch wohl?“ „Natürlich! Stets vier Buchstaben für Handelsschiffe, nicht? Und D heißt z. B. Deutschland.“ „Jawohl, der erste Buchstabe bezeichnet immer die Nationalität. Dann haben wir also noch an Schiffspapieren den Schiffsmeßbrief, der maßgebend ist für die Berechnung der Lotsengelder, Hafenabgaben, Dockgebühren, Kanalgelder usw. Grundlage ist die Registertonne. Der Flaggenschein zeigt, daß z.B. ein deutsches Schiff unter dem Schutz des Reiches steht, der Fahrterlaubnisschein
der Seeberufsgenossenschaft bescheinigt die Betriebssicherheit, die Klassenzertifikate des Germanischen Lloyd sind Grundlage für die Versicherung des Schiffes, das Freibordzeugnis stellt das Maß des Freibords, also die Ladefähigkeit fest, und schließlich die Musterrolle ist der Paß der Besatzung. Das ist so ziemlich alles. Natürlich hat jeder einzelne Seemann seine besonderen Papiere wie Seefahrtsbuch, Dienstzeugnisbuch und Heuerschein. Ohne Papier geht es nun einmal selbst bei der christlichen Seefahrt nicht!“ Der Erste Offizier, wie immer überall dort im Schiff, wo gerade etwas los ist, erscheint. Er hat den letzten Teil unseres Gesprächs angehört und hebt warnend den Zeigefinger: „Wissen Sie auch, mein Kapitän, was man pfeifen lassen muß, wenn z. B. ein Prisenkutter an Backbord längsseit liegt?“ „Nein, Herr Kapitän, keine Ahnung!“ „Man muß an der Leeseite Bier ausgeben lassen, damit nicht alles nach Luv läuft und der Ausguck darunter leidet!“ „Sehr gut, das werde ich dem A.O. sagen, der trinkt doch so gerne Bier!“ Vergnügt reibt sich der Fregattenkapitän die Hände, es ist kalt geworden, seit die Sonne völlig verschwand und der Himmel sich langsam mit schweren dunkelgrauen Wolken bezogen hat. Mehrere Dampfer passieren, mit Tarnbemalung versehene deutsche, davon zwei schwarz und weiß gescheckte deutsche Vorpostenboote ehemalig Fischdampfer, die nun die Kriegsflagge
an der Gaffel fahren, und ein kleines Geschütz auf der hohen Back und Minensuchgerät hinter den schweren Fischdampferwinden am Heck stehen haben. Norweger, Schweden und Holländer gleiten vorüber, neugierig lehnen Matrosen in Pudelmützen und bunten Halstüchern über dunkelblauen Jumpern an der Reling und schauen herüber. Groß und leuchtend weiß stehen die Namen der Heimatländer: Norge, Sverige, Nederland neben oder zwischen den Nationalflaggen, die auf die Seitenwände aufgemalt sind. Mächtig qualmend, ziehen die Dampfer vorüber, lange noch stehen ihre Rauchfahnen über der See. Als es dämmert, blitzen Leuchtfeuer auf. Wegweiser und Freunde in der Nacht, die aus dem Dunst, der über der fernen Küste liegt, weißlich und rot hervorblinzeln. In dieser Nacht zieht zum ersten Male die Kriegswache voll auf. In den Gängen des achteren Wohndecks, vor den Kammern und der Messe macht die Kriegsfreiwache zum Schlafen klar, in die Messe selbst, die querschiffs das Aufbaudeck achtern abschließt, ziehen die Geschützführer und Bedienungsmannschaften der achteren Geschütze ein, stellen die Stühle beiseite, breiten Wolldecken und Hängematten aus, verdunkeln die Deckslampen und legen sich zum Schlafen hin. Nur ein paar Unentwegte versuchen trotz der trüben Beleuchtung schnell noch ein paar Seiten aus ihren 20-Pfennigs-Schmökern zu lesen, die immer noch trotz der reichhaltigen und sehr guten Schiffsbibliothek die zahlreichsten Leser aufzuweisen haben. Wie sagte doch irgend jemand
einmal sehr treffend auf einer Versammlung des ehemaligen Kampfbundes für deutsche Kultur? Es war ein Satz, der leider, allen Bemühungen sämtlicher dafür interessierten Stellen zum Trotz immer noch seine Geltung hat: „Der Appell an den Kitsch hat noch stets in deutschen Seelen brausenden Widerhall gefunden!“ Man soll das ja nicht schamhaft verschweigen, es ist so. Jeder Kriegsschiffskommandant, jeder Unterseebootoffizier kann es bestätigen: wohl gibt es einzelne, die gute Bücher aus den überall vorhandenen Schiffsbibliotheken verlangen, die Mehrzahl – Gott sei’s geklagt! – verschlingt aber immer noch die billigen Kitschbücher mit den blutrünstigen oder sentimentalen Titeln, Hefte, die halb zerrissen und fürchterlich beschmutzt, von Hand zu Hand gehen und offenbar ihre Leser mehr befriedigen als die ausgesuchtesten, besten und interessantesten Bücher. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre die Beantwortung dieser Frage ein nutzliches Thema für eine Doktorarbeit. Es ist jetzt, abgesehen von den spärlichen blau gemalten Deckslampen auch im Schiff dunkel, das nach außen selbstverständlich schon immer abgeblendet wurde. Und man muß sehr vorsichtig gehen, wenn man, von der Brücke kommend, zu seiner Kammer will. Dicht vor der Tür schläft stets ein Matrose, gerade neben dem Niedergang ins Zwischendeck. Im langen Gang zur Messe liegen stets mehrere Männer, schwach beleuchtet vom Licht der Telephonzelle vor der Pantry, in der immer ein Posten hockt, eine Zeitung oder einen der oben erwähnten Schmöker auf dem Schoß.
Kriegswache! das heißt: alle Waffen zur Hälfte besetzt, das heißt, daß bei Alarm die Kriegsfreiwache, das heißt die Hälfte der seemännischen Besatzung an Geschütze und Ausstoßrohre stürzt, das heißt, daß wir von nun an mit Feindbegegnung rechnen, zum mindesten, daß es nicht unmöglich ist, daß plötzlich aus dem Dunkel der Nacht der Gegner auftaucht und angreift. Kriegswache bedeutet wieder eine Steigerung in der Reihe der kriegsmäßigen Vorbereitungen, die seit dem Verlassen des Hafens befohlen wurden. Mit dem Gefühl, daß jede zurückgelegte Meile uns näher an unser Operationsgebiet heranträgt, daß das Geschehen, das man nun schon mit kurzen Unterbrechungen seit neunzehn Monaten nur am Schreibtisch mit heißem Herzen und tausend Wünschen verfolgen durfte, bald zum eigenen Erlebnis werden wird, schalte ich in der Kammer die Schreibtischbeleuchtung ein und mache meine Notizen in das dicke schwarze Buch, das eigens zu diesem Zweck mitgenommen wurde. Ganz still ist es nun im Schiff, nur das eintönige Mahlen der Schrauben ist als leichtes Zittern zu spüren, seit um 20 Uhr 10 der Bootsmannsmaat der Wache seinen letzten Befehl auspfiff: „Freiwache Ruhe auf Hängematten auf den Kriegswachschlafplätzen.“ Ein eigenartiges Gefühl, in dieser absoluten Stille, die nur vom Schraubengeräusch untermalt wird, allein in der Kammer zu sitzen, während rings unter Deck alles schläft, und oben die Augen der Ausgucks auf Brücken und an Geschützen, an Ausstoßrohren und
Scheinwerfern, Entfernungsmeßgeräten und Flawaffen glasbewehrt in die Finsternis schauen und jeden Augenblick die Alarmklingeln rasseln und dies scheinbar schlafende Schiff mit all seinen Männern und Waffen zu lebendigstem, todbringendem Leben erwecken können. Ein neuer Tag steigt mit der aufgehenden Sonne aus der See, die mit dem erwachenden Licht wie ein grünlich schimmerndes seidiges Tuch mit hellblauen weichen Falten weithin sich spannt. Ich stehe bei den Leichten Flageschützen hinter dem achteren Stand und lasse mir, ebenso wie die Bedienungsmannschaften, die warme Morgensonne auf den Pelz scheinen. Über uns dreht der Entfernungsmesser langsam sein Gerät und sucht systematisch die Kimm nach feindlichen Flugzeugen ab. Unter uns, leicht erhoben, drohen die Rohre des Trumes Caesar und im Kielwasser hängen nun drei Zerstörer, die in Kiellinie unserem Kurs folgen. An Backbord liegt, flach auf der ruhigen See, eine langgestreckte Insel. Strahlend weiß steht ein schlanker Leuchtturm an ihrem rechten Ende über hellbraunem Sandstrand. Ein Obergefreiter vom Flageschütz sieht mich fragend an: „Wie heißt die Insel, Herr Kapitän?“ Ich nenne den Namen, der im Mittelalter eine gewisse Rolle spielte: „Haben Sie mal was von Paul Beneke, dem Danziger Seehelden, gehört?“ „Nein, Herr Kapitän.“ „Na, der hat hier, bei dieser Insel einen seiner besten Streiche ausgeführt. Hören Sie zu!“
Außer dem Ausguck treten die anderen heran, als ich die berühmte Geschichte von jenem „harten Seevogel“ erzähle, wie die Danziger Chronik diesen tüchtigen Seemann und Admiral nannte: „Steuermann war Paul Beneke, Steuermann auf der Danziger Kogge ‚Mariendrache’, als 1466 die Geschichte bei dieser Insel da drüben passierte. Eines Tages war im holländischen Hafen Zween ein Danziger Kaperkapitän, Merten Berdewig, mit seiner Kogge ‚Pomuchel’ unter Notsegeln eingelaufen. Sie war fein zusammengeschossen, Großmast weg und auch sonst ziemlich zerzaust. War Begleiter eines Konvois gewesen, der unter der roten Flagge mit der Danziger Krone und den Kreuzen segelte. Die Dänen hatten diesen Geleitzug geschnappt. Die Danziger beschließen sich zu rächen, bessern die ‚Pomuchel’ aus, malen sie und die ‚Mariendrache’, die ebenfalls in Zween lag, schwarz, daß sie wie harmlose Frachter aussehen, und verdecken die Geschützpforten mit geteerten Persennings. Dann laufen sie aus. Sie haben Glück, treffen unterwegs einen der drei Dänen, die den Danziger Geleitzug gekapert hatten, überwältigen ihn und holen aus dem Kapitän alles heraus, was sie wissen wollen. So erfahren sie, daß die beiden anderen Dänen noch unter jener Insel drüben im Schutz einer Landbatterie liegen und die vier genommenen Danziger bewachen, die sie eben dorthin brachten. Der Rest des ehemaligen Danziger Geleitzugs war doch noch entwischt. Sie sehen, das Geleitzugswesen ist durchaus keine Erfindung der Engländer, die gab es schon im Mittelalter! Sie segeln nun die Insel an, Paul Beneke läuft mit
der Prise als Däne vorauf, während die beiden Danziger Fredekoggen, ‚Pomuchel’ und ‚Mariendrache’ draußen liegenbleiben. Die List gelingt: in der Dämmerung läuft die Prise unter dänischer Flagge ein und geht zwischen den beiden Dänen und den Danziger Koggen im Hafen zu Anker. Sechzig Danziger Matrosen und Ruters, das sind Wappner, Seesoldaten, pullen in Booten zum nächsten Dänen, überwältigen die ahnungslosen Wachtposten und nageln die Luken dicht, damit die schlafende Mannschaft nicht an Deck kann. Beim zweiten geht es nicht so einfach, der Posten schlägt Alarm, die Dänen erwachen und wehren sich, werden aber nach kurzem blutigen Kampf auf die gleiche Weise unschädlich gemacht. Schüsse sind bei diesem Gefecht nicht gefallen, so gelingt es, auch die Landbatterie mit schnell an Land geworfenen Ruters unter Führung des kühnen Steuermanns in die Hand zu bekommen und die Kanonen zu vernageln. Die Danziger sind nun Herren des Hafens, machen die vier von den Dänen geraubten Koggen vom Bollwerk los und nehmen dazu noch sechs dänische Frachter, die unbewacht ebenfalls an der Pier liegen. Bald liegen dreizehn Koggen draußen, der Stadt gegenüber vor dem Hafen. Am Morgen, als der dänische Hafenmeister wütend zum angeblich dänischen Flaggschiff herausgerudert kommt, fliegen an allen Toppen die roten Danziger Flaggen hoch und es ist nun leicht – im Hinblick auf die Geschütze der Fredekoggen! – den Dänen zu bewegen, die noch an Land festgehaltenen Besatzungen von vier Danziger Koggen zu befreien und für sie ein Schmerzensgeld von 10000 Pfund Groschen, das ist
etwa eine Viertelmillion Mark, zu erreichen. Drei Stunden später erscheinen die beiden Danziger Fredekoggen, gerade, als die ganze Flotte ankerauf geht: 13 Schiffe, alle unter der Flagge Danzigs, drei dänische Kriegsbarsen, Schnellsegler, die etwas kleiner als die Koggen und die Vorläufer der Fregatten waren, sechs dänische Frachter und vier Danziger Handelskoggen. Der Streich ist vollkommen geglückt, die Schlappe des alten Merten Berdewig wieder gutgemacht! Paul Beneke, der die treibende Kraft der ganzen Unternehmung gewesen war, wurde nach der Heimkehr feierlich zum Schiffshauptmann der Hansestadt ernannt und erhielt den Befehl über die größte der genommenen dänischen Barsen, die zum Gedenken der kühnen Tat den Namen der Insel erhielt.“ „Das habe ich gar nicht gewußt, daß damals schon Geleitzüge fuhren, und von diesem Beneke habe ich nie etwas gehört,“ meint der Obergefreite und sieht nachdenklich zur Insel hinüber, die langsam achteraus kommt. Plötzlich tritt, gewaltig anzuschauen, das Flaggschiff in unseren Gesichtskreis. Eine Kursänderung ist befohlen und nun, während „Bismarck“ schwenkt, staunen wir wieder über dies ungeheure Kriegsschiff, dessen Formen für kurze Zeit in ihrer ganzen Länge und Schönheit, hell beschienen von der Sonne, sichtbar werden. Phantastisch klar, messerscharf ist die Kimm, die das grünblaue Wasser vom lichten, zartblauen Himmel scheidet. Es ist wirklich eine Lust, zur See zu fahren,
ein gutes Schiff unter den Füßen zu haben, Kameraden um sich, die mit den Waffen dieses Kreuzers umzugehen verstehen, die wärmende Sonne zu fühlen und zu wissen, daß es gegen den Feind geht, den wir irgendwann, in nicht allzu ferner Zeit, da draußen treffen müssen und treffen werden. Nur ungern gehe ich zur vorher festgesetzten Zeit in die Kammer des I.A.O., um Näheres über die Artillerie des Schweren Kreuzers, ihre Einsatzmöglichkeiten, die vielen Wege und Reservewege der Befehlsübermittlung, über Maßnahmen bei Ausfällen, Munitionsnachschub, Entfernungsmeßgeräte un Scheinwerferpraxis, über die Verteilung der zur Artillerie gehörenden Offiziere, über Kriegswachverteilung und Einsatz bei Fliegeralarm zu hören. So sitzen wir über Tabellen und Schiffsplänen, Schußtafeln und Akten, während draußen die Sonne scheint und der Widerschein des Wassers tanzende goldene Kringel an die Decke der Kammer wirft. Der Korvettenkapitän zieht ein dickes schwarzes Notizbuch aus der Jackettasche: „Sehen Sie, hier ist alles drin. Man wird so oft nach allem möglichen gefragt, was ich einfach im Kopf nicht behalten kann. Zahlen natürlich, die Schlauere wie ich stets herunterrasseln können, aber - “ „Zahlen, mein Lieber, kann ich auch nicht behalten, unmöglich!“ unterbreche ich lachend und blättere in dem Heft, das der A.O. mir gereicht hat. „Nehmen Sie an, der Kommandant fragt plötzlich aus heiterem Himmel nach der Größe des Verbrennungsraums der Rohre im Turm Anna. Kein Mensch kann das
auswendig wissen. Hier steht es! Natürlich habe ich – alles in alphabetischer Reihenfolge, nach Stichworten geordnet – auch Dinge aufgeschrieben, die ich tatsächlich im Traum auswendig weiß, so z. B. das berühmte ‚Gebet vor der Schlacht’.“ „Wa ist denn das nun wieder?“ „Nichts anderes als die Anfangskommandos. Die nennen wir so. Die stehen so mehr der Vollständigkeit halber drin, wissen Sie.“ Als wir die Kammer wieder verlassen, legen die Männer draußen auf Back und Schanz die Reling nieder. Wieder eine Steigerung der Gefechtsbereitschaft, wieder ein Zeichen dafür, daß es bald Ernst werden kann. In der Ferne blaut eine Küste mit hohen Bergzügen, Fischerboote, schneeweiß gemalt, das gelbe Kreuz Schwedens auf blauem Grund, dümpeln in unserem Kielwasser, lusting knattern und puffen ihre starken Motoren, weißer Gischt sprüht am Bug und achtern stehen unbeweglich, breitbeinig die Bewegungen des Bootes ausbalancierend, die drei Mann der Besatzung. Auf unserer Schanz bespricht der Erste Offizier mit dem Oberbootsmann irgend etwas. Ich grüße den Fregattenkapitän, der mich heranwinkt: „Ich stelle gerade fest, wie wir die Strecktaue ausbringen werden. Wenn wir nachher die Enge Shetland-Bergen passiert haben, kann ein schöner Seegang stehen und die Männer fallen mir außenbords. Deshalb lasse ich die Dinger lieber zu früh als zu spät ausbringen. Und hier,“ er wendet sich an den Oberbootsmann, „werden überall parallel zur Bordwand in zwei Meter
Abstand dicke weiße Striche gemalt, die dürfen nicht überschritten werden!“ Am Nachmittag tauchen an Steuerbord Minensuchboote auf. Hellgrau, fast weiß, steuern sie, während unsere Kampfgruppe Fahrt vermindert, im grellen Licht dahin, überholen uns, die Flagge Aegir an den Rahen, und gehen von uns in Suchformation. An Backbord verhalten unsere drei Begleitzerstörer ebenfalls und warten. Ich überlege gerade, neben dem Kommandanten auf der Brücke stehend, ob es sich lohnen wird, den Filmapparat noch schnell heraufzuholen, als auch schon vorn bei der Suchgruppe zwei Minendetonationen erfolgen. Eine weiße und eine tiefschwarze Detonationswolke springt hinter den Booten auf, dann eine dritte, gerade als der langnachballende Donner der ersten Sprengungen uns erreicht. „Das hätten Herr Kapitän filmen müssen!“ sagt vorwurfsvoll der Rollenoffizier. „Natürlich, Mensch! Bloß müßt ihr mir vorher Bescheid sagen, wenn so etwas Besonderes hier geboten wird! Ich kann doch nicht dauernd mit diesem schweren Apparat herumrennen! Zu blöde, so was! Na, jetzt hat es keinen Zweck mehr!“ Trotzdem stürze ich zur Kammer, reppe den Filmapparat aus dem Spind und versuche, wenigstens die M-Bootsgruppe noch zu erwischen, die weitersucht. Aber es wird keine Mine mehr gefaßt, und als nach wenigen Stunden die Boote vom Flaggschiff entlassen, in Marschformation wie ein Keil großer Schneegänse davonfahren, brausen die Zerstörer zur U-Bootsicherung des Kampfverbandes
seitlich heraus und nach vorn, während „Bismarck“ und „Prinz Eugen“ in Dwarslinie mit hoher Fahrt angehn. Als hätte ein Zauberer seine Sprüche gemurmelt, hängt plötzlich der Himmel voller deutscher Flugzeuge: Seeaufklärer brummen über uns, Ketten von schnellen Zerstörern, Me 110, brausen wie lange Bleistifte mit dröhnenden Motoren seitlich und vor der Kampfgruppe über die See und sichern. Als ich in die Kammer komme, steht alles unter Wasser. Das ist vor wenigen Tagen dem A.O. auch passiert und damals hatte ich ganz stolz behauptet, daß das bei mir niemals vorkommen könnte: „Mein Aufklarer hat eben strikte Weisung, den Wasserhahn eisern zu schließen, wenn er die Kammer verläßt!“ Jawohl: nun ist es bei mir auch so weit. Da das Frischwasser zum Waschen zu ganz bestimmten Stunden läuft, und die Aufklarer für ihre Offiziere eine gefüllte Waschschüssel zum Händewaschen klarhalten wollen, drehen sie an und vergessen den Hahn wieder zu schließen, wenn sie ihre Arbeit in der Kammer beendet haben. Inzwischen stellt die Maschine das Frischwasser an und die Kammer läuft langsam voll. Daß es nicht ganz einfach ist, solch vollgelaufene Kammer wieder klarzukriegen, habe ich bemerkt, als ich mit Hilfe des Läufers Messe und des schleunigst herbeizitierten Aufklarers Ordnung schaffen wollte. Vor allem der Bodenbelag, die dicken Teppichstücke trockneten nicht nur sehr langsam auf dem Außendeck, sondern waren noch dazu, als wir sie endlich wieder hereinholen konnten, erheblich zusammengeschrumpft.
Als ich dem A.O. von dem Unglück erzählte, meinte er ganz trocken: „Was wollen Sie denn? Ich habe mit meinem Aufklarer ganze vier Stunden gebraucht, bei mir stand aber auch das Wasser gut einen halben Meter hoch, denn dies verdammte Süll an meiner Kammer ließ ja nichts ablaufen! Wieviel Eimer und Pützen Frischwasser wir mühsam rausschleppten, weiß ich gar nicht mehr. Aber schön ist es doch, daß Ihnen das auch mal passiert ist!“ Schadenfreude ist eben die reinste Freude! Von diesem Tage an bin ich bis zum Schluß der Unternehmung nachts die Kriegswache bei der Steuerbordwache mit dem Ersten Artillerieoffizier mitgegangen. Es sind in meiner Erinnerung die schönsten Stunden, die mir auf dem Schweren Kreuzer vergönnt waren, diese Stunden, in denen wir gespannt und erwartungsvoll die hellen Nächte des nördlichen Eismeers und die sternklaren, dunklen Nächte des Atlantik gemeinsam erlebten, Ausguck haltend, die Lage besprechend, und immer wieder mit Glas und Auge die unermeßliche Weite nach Rauchfahnen und Mastpitzen, Flugzeugen und U-Bootsehrohren absuchend. Nur hier, mit eingespannt in den Dienst, in die Kampfgemeinschaft unseres Schiffes, war es möglich, die Eindrücke zu sammeln, die täglich und stündlich in wechselvoller Fülle auf jeden einstürmten, der diese Unternehmung der Kampfgruppe „Bismarck“ mit wachen Sinnen stolz miterlebte.
|

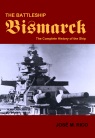 BOOK: The Battleship Bismarck. The Complete History of the Ship.
 Naval & military gifts
|